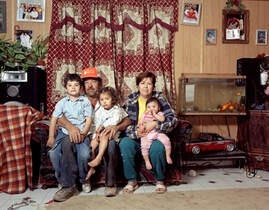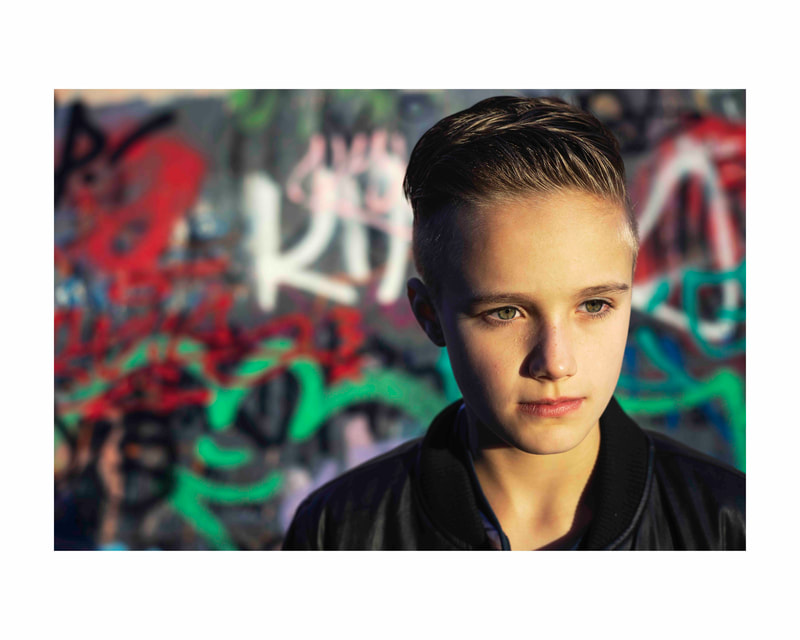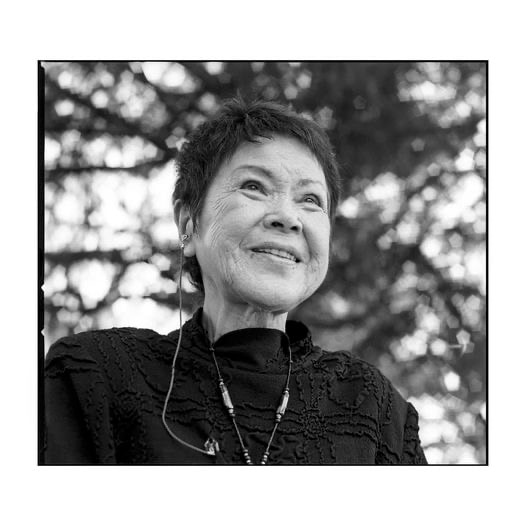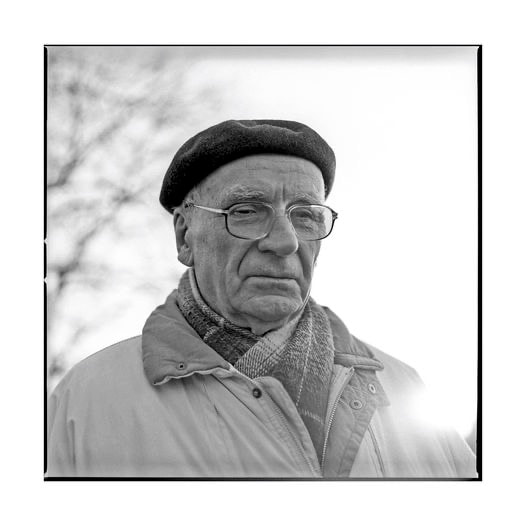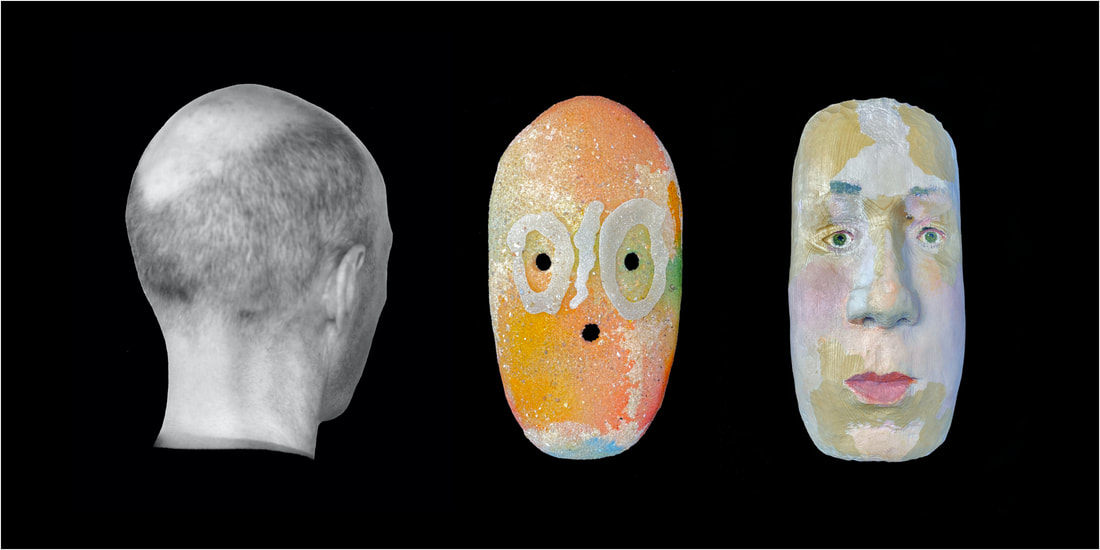Latest Entry:
Sandra Rosenstiel: "Ich bin nicht da"
Archive:
Andrew Phelps: "Higley und Haboob"
Tomasz Lewandowski: "Polish Summer"
Lucas Oertel: "draußen"
Newsha Tavakolian, Bahram Shabani, Laurence Raste, Hanna Darabi, NavidReza Haghighi: "Inside Iran"
Phillip Hailperin zur Entstehung von "Passers-by"
Bogdan Konopka, Misha Kominek und Katarzyna Mazur: "Polen in meinen Augen. Die Heimreise"
Paule Saviano: "Embrace"
Paule Saviano: "From Above - Überlebende der Bombenkriege des zweiten Weltkrieges"
Ruth Unger, Lucas Oertel, Jürgen Schmidt: "Persona"
Katarzyna Mazur: "ANNA KONDA"
Hansgert Lambers: "Verweilter Augenblick"
Sandra Rosenstiel: "Ich bin nicht da"
Archive:
Andrew Phelps: "Higley und Haboob"
Tomasz Lewandowski: "Polish Summer"
Lucas Oertel: "draußen"
Newsha Tavakolian, Bahram Shabani, Laurence Raste, Hanna Darabi, NavidReza Haghighi: "Inside Iran"
Phillip Hailperin zur Entstehung von "Passers-by"
Bogdan Konopka, Misha Kominek und Katarzyna Mazur: "Polen in meinen Augen. Die Heimreise"
Paule Saviano: "Embrace"
Paule Saviano: "From Above - Überlebende der Bombenkriege des zweiten Weltkrieges"
Ruth Unger, Lucas Oertel, Jürgen Schmidt: "Persona"
Katarzyna Mazur: "ANNA KONDA"
Hansgert Lambers: "Verweilter Augenblick"
Andrew Phelps: "Higley und Haboob"
Kunsthaus Raskolnikow/Galerie 8.4. - 26.5.2016
veranstaltet vom FOTOFORUM Dresden
Kunsthaus Raskolnikow/Galerie 8.4. - 26.5.2016
veranstaltet vom FOTOFORUM Dresden
Andrew Phelps wird 1967 in der Nähe von Phoenix, Arizona geboren. Gemeinsam mit seinem Vater erkundet er die großartige Natur des amerikanischen Südwestens und versucht sie in Fotos festzuhalten, orientiert an der heroisierenden Landschaftsfotografie jener Zeit. 1986 schreibt er sich für das Fach „Fotografie“ an der Arizona State University ein. 10 Jahre bevor er dieses Studium beginnt, leitete die Ausstellung "New Topographics: Photographs of a Man-altered Landscape" einen Paradigmenwechsel in der US-amerikanischen Fotografie ein. Die Schau am George Eastman House in Rochester, New York, zeigt Fotografien von Robert Adams, Lewis Baltz, Stephen Shore und einigen anderen. Ihnen gemeinsam ist, den Alltag in all seiner ganzen Gewöhnlichkeit abzubilden.
Rückschauend betrachtet, kündigt sich mit "New Topographics" eine Abkehr von der bis dahin durch Fotografen wie Ansel Adams oder Edward Weston geprägten visuellen Tradition an, die unberührte Natur, eine wie auch immer geartete heile Welt, fotografisch zu vermitteln. Für Andrew Phelps wie für viele andere Fotografen seiner Generation wird "New Topographics“ zu einem prägendem Leitbild und bedeutet für ihn gleichzeitig eine Absage an die Schöne-Welt-Fotografie, die ihn zunächst zum Studium motiviert hatte. William Jenkins, der Kurator eben jener Ausstellung von 1975, war Phelp’s Professor an der Universität. Andrew Phelps selbst sagt, dass Jenkins seinen Zugang zur Fotografie wie kein anderer beeinflusste. Als Fotograf inspiriert ihn vor allem Robert Adams – einer der wichtigsten Vertreter der „New Topographics“-Bewegung.
Nach einem Studienaufenthalt am Salzburg College lebt Andrew Phelps mit Frau und Kindern seit den 90iger Jahren permanent in Salzburg. Die Beschäftigung mit Higley, der Kleinstadt in Arizona, folgt zunächst einem ausschließlich persönlichen Impuls. Hier, nicht fern der Großstadt Phoenix betrieb sein Großvater eine Farm und er selbst wuchs in der Gegend auf. Nach der Geburt seiner ersten Tochter, trägt er sich mit dem Gedanken, fotografisch zu dokumentieren, woher er kommt, wo seine Wurzeln liegen. Den letzten Anstoß, in die alte Heimat zu reisen, gibt der Anruf seiner Schwester, die ihn damit überrascht, dass sie in Higley ein Haus gekauft habe und sich dort niederlassen wolle. So kehrt er also nach Jahren zurück und muss feststellen, dass von der einstigen ländlichen Idylle kaum etwas übrig ist. Phoenix, die nahe Großstadt, expandierte gewaltig – die Zahl der Einwohner verdoppelte sich zwischen 1980 und 2010 auf etwa 1,5 Millionen. Angetrieben von billigem Bauland, einer boomenden Wirtschaft und 300 Sonnentagen im Jahr, wurden immer mehr Umlandgemeinden von der Großstadt verschluckt. Higley verlor schließlich 2007 seine Selbständigkeit. Die Kleinstadt und die umgebende Agrarlandschaft sind von einförmigen Wohnsiedlungen, Einkaufszentren und Tankstellen an breiten Straßen verdrängt worden. Andrew Phelps ist erschüttert. Gleichwohl macht er sich daran, den Ort seiner Kindheit, der kaum noch wieder zu erkennen ist, zu dokumentieren: das Alte, soweit noch vorhanden, wie auch das Neue. 2007 publiziert er die Aufnahmen in einem Buch mit dem Titel „Higley“. Es gibt darin Bilder von Menschen, ihren Häusern und den darin befindlichen alltäglichen Gegenständen, auch Häuser, die aufgegeben wurden und verfallen.
Rückschauend betrachtet, kündigt sich mit "New Topographics" eine Abkehr von der bis dahin durch Fotografen wie Ansel Adams oder Edward Weston geprägten visuellen Tradition an, die unberührte Natur, eine wie auch immer geartete heile Welt, fotografisch zu vermitteln. Für Andrew Phelps wie für viele andere Fotografen seiner Generation wird "New Topographics“ zu einem prägendem Leitbild und bedeutet für ihn gleichzeitig eine Absage an die Schöne-Welt-Fotografie, die ihn zunächst zum Studium motiviert hatte. William Jenkins, der Kurator eben jener Ausstellung von 1975, war Phelp’s Professor an der Universität. Andrew Phelps selbst sagt, dass Jenkins seinen Zugang zur Fotografie wie kein anderer beeinflusste. Als Fotograf inspiriert ihn vor allem Robert Adams – einer der wichtigsten Vertreter der „New Topographics“-Bewegung.
Nach einem Studienaufenthalt am Salzburg College lebt Andrew Phelps mit Frau und Kindern seit den 90iger Jahren permanent in Salzburg. Die Beschäftigung mit Higley, der Kleinstadt in Arizona, folgt zunächst einem ausschließlich persönlichen Impuls. Hier, nicht fern der Großstadt Phoenix betrieb sein Großvater eine Farm und er selbst wuchs in der Gegend auf. Nach der Geburt seiner ersten Tochter, trägt er sich mit dem Gedanken, fotografisch zu dokumentieren, woher er kommt, wo seine Wurzeln liegen. Den letzten Anstoß, in die alte Heimat zu reisen, gibt der Anruf seiner Schwester, die ihn damit überrascht, dass sie in Higley ein Haus gekauft habe und sich dort niederlassen wolle. So kehrt er also nach Jahren zurück und muss feststellen, dass von der einstigen ländlichen Idylle kaum etwas übrig ist. Phoenix, die nahe Großstadt, expandierte gewaltig – die Zahl der Einwohner verdoppelte sich zwischen 1980 und 2010 auf etwa 1,5 Millionen. Angetrieben von billigem Bauland, einer boomenden Wirtschaft und 300 Sonnentagen im Jahr, wurden immer mehr Umlandgemeinden von der Großstadt verschluckt. Higley verlor schließlich 2007 seine Selbständigkeit. Die Kleinstadt und die umgebende Agrarlandschaft sind von einförmigen Wohnsiedlungen, Einkaufszentren und Tankstellen an breiten Straßen verdrängt worden. Andrew Phelps ist erschüttert. Gleichwohl macht er sich daran, den Ort seiner Kindheit, der kaum noch wieder zu erkennen ist, zu dokumentieren: das Alte, soweit noch vorhanden, wie auch das Neue. 2007 publiziert er die Aufnahmen in einem Buch mit dem Titel „Higley“. Es gibt darin Bilder von Menschen, ihren Häusern und den darin befindlichen alltäglichen Gegenständen, auch Häuser, die aufgegeben wurden und verfallen.
Andrew Phelps, 2004-2012
Kaum hatte Andrew Phelps die Arbeit an diesem Buch beendet, platzt in den USA die Immobilienblase. Am 15. September 2008 bricht die Investmentbank "Lehman Brothers" zusammen. Die Krise beendet abrupt den Bauboom in den USA, so auch in Higley. Andrew Phelps kehrt ein weiteres Mal nach Higley zurück und wird Zeuge des Niedergangs. Zahlreiche neue Häuser finden keine Käufer mehr, manche können nicht fertig gestellt werden und stehen halbfertig in der Landschaft. Andrew Phelps veröffentlicht seine in dieser Zeit entstandene Serie 2012 unter dem Titel „Haboob.“ Dieser Begriff steht in Arizona für Unheil bringende Sandstürme und ist zugleich ein Sinnbild für die zerstörerische Wirkung von Boom und Krise in jener Zeit. Im Unterschied zu „Higley“ enthält „Haboob“ nur wenige Bilder von Menschen und wenn, dann nur aus der Distanz. Ob beabsichtigt oder nicht, Andrew Phelp’s Bilder transportieren über die persönliche Spurensuche hinaus eine politische Botschaft. Sie sind zugleich Dokumentation und Kritik an gesellschaftlichen Entwicklungen. Wie unter einem Vergrößerungsglas bilden sich in Higley die Folgen des ungebremsten Wachstums, der scheinbar unaufhaltsamen Urbanisierung und Zersiedelung ganzer Landstriche ab. Higley steht dabei exemplarisch für die globalisierte, vor allem von wirtschaftlichen Interessen, gelenkten Welt.
Text: J. Schmidt, 03/2016
Text: J. Schmidt, 03/2016
Tomasz Lewandowski: "Polish Summer"
Kunsthaus Raskolnikow/Galerie 26.10. - 07.12.2018
veranstaltet vom FOTOFORUM Dresden
Kunsthaus Raskolnikow/Galerie 26.10. - 07.12.2018
veranstaltet vom FOTOFORUM Dresden
Polen wie Europa befinden sich gegenwärtig in einem Zustand der Spaltung. Liberale demokratische Grundwerte werden in Frage gestellt, nationalistische Tendenzen sind auf dem Vormarsch. Tomasz Lewandowski, in Polen geboren und aufgewachsen, kam vor Jahren zum Studium nach Deutschland. Seitdem lebt und arbeitet er in Halle, kehrt aber immer wieder in sein Heimatland zurück, um die gesellschaftliche Situation in Polen mit dem Medium der Fotografie zu dokumentieren.
Am 11. November 1918 wurde in der Folge des ersten Weltkrieges die Zweite Polnische Republik ausgerufen. Kaum hatte sich der junge Staat konsolidiert, griff am 1. September 1939 das Deutsche Reich Polen an und besetzte die westlichen Landesteile. Ostpolen wurde gemäß dem Ribbentrop-Molotow-Pakt kurz darauf von der Sowjetunion vereinnahmt. Das nationalsozialistische Besatzungsregime wütete grauenvoll. In deutschen Konzentrationslagern auf polnischem Boden wurden 6 Millionen Polen, ca. 16,5% der Gesamtbevölkerung, darunter 3 Millionen polnische Juden, ermordet. Nach Ende des zweiten Weltkrieges entstand auf einem nach Westen verschobenen Territorium mit der Volksrepublik Polen ein sowjetischer Vasallenstaat. Die Umwälzungen in Osteuropa, in Polen die Gewerkschaftsbewegung „Solidarność“ und die Wahl Karol Wojtyłas, eines polnischen Bischofs, zum Papst Johannes Paul II., dem Oberhaupt der mächtigen römisch-katholischen Kirche, führten schließlich 1989 zur Ablösung des kommunistischen Regimes. Freie Wahlen markierten den Beginn der Dritten Republik. 2004 trat Polen der Europäischen Union bei, was zur erfolgreichen wirtschaftlichen Entwicklung Polens in den Folgejahren maßgeblich beitrug. Derzeit wird Polen von der nationalkonservativen PiS-Partei regiert, die auf einen Obrigkeitsstaat hinarbeitet, jedoch wegen ihrer Sozialpolitik Zustimmung in großen Teilen der Bevölkerung genießt.
100 Jahre Neugründung Polens und die jüngsten politischen Verwerfungen sind Anlass, die Fotoserie „Polish Summer“ einem größeren Publikum zu präsentieren. Für diese Serie reiste Tomasz Lewandowski mehrfach durch seine polnische Heimat. Seine Fotografien zeigen einerseits Szenen aus dem Alltag, anderseits politisch und historisch relevante Orte und Objekte im Polen der Gegenwart. Weil er sowohl in Polen als auch in Deutschland zu Hause ist, kann er seine Heimat aus einer ganz eigenen Perspektive betrachten. Er sieht Polen gleichermaßen durch die Augen eines Fremden wie eines Einheimischen. Als Fotokünstler beschäftigt sich Lewandowski vor allem mit der soziologischen Dimension der Architektur. Es verwundert daher nicht, dass ein Großteil seiner Fotografien Gebäude, Straßen und Plätze zeigen. Dennoch bilden die Aufnahmen die sozialen Verhältnisse und die Lebensgewohnheiten der Polen auf einzigartige Weise ab. In ihnen drückt sich der wirtschaftlich-soziale Wandel ebenso aus wie die politisch-ideologischen Umbrüche der letzten Jahrzehnte. Es sind die Autobahnen und Einkaufszentren als Symbole des wirtschaftlichen Aufstiegs, die den Übergang Polens in die kapitalistische Welt des Westens markieren. Daneben finden sich die Relikte der sozialistischen Vergangenheit: anonyme Plattenbauten oder vernachlässigte Altstadtviertel. Und auch dort, wo nicht große Investoren oder der Staat ihre Hände im Spiel haben, wird erkennbar, wie sich in der Architektur die Wünsche und Träume der Polen manifestieren. Hier verkündet die Villa unmissverständlich den wirtschaftlichen Erfolg des Erbauers oder die feilgebotenen Gartenfiguren den Hang zu kleinbürgerlicher Idylle. Schließlich fordert die „Freizeit-Gesellschaft“ immer ausgefallenere Attraktionen, ein ausrangiertes Flugzeug wird zum Restaurant, mitten in der Agrarlandschaft wachsen stählerne Achterbahnen aus dem Boden. Andere liebenswerte Objekte, wie die typischen Kioske, verschwinden aus dem Stadtbild. Mit der Darstellung politisch und historisch relevanter Orte und Gedenkstätten konfrontiert der Fotograf den Betrachter mit Geschehnissen, die in Polen heute vielleicht eher verdrängt als wahrgenommen werden. In Zeiten eines neu aufkommenden Patriotismus gesteht man sich dunkle Kapitel der jüngeren Vergangenheit ungern ein, wie beispielsweise die Existenz von Arbeitslagern während der kommunistischen Herrschaft in den Jahren nach dem 2. Weltkrieg.
Am 11. November 1918 wurde in der Folge des ersten Weltkrieges die Zweite Polnische Republik ausgerufen. Kaum hatte sich der junge Staat konsolidiert, griff am 1. September 1939 das Deutsche Reich Polen an und besetzte die westlichen Landesteile. Ostpolen wurde gemäß dem Ribbentrop-Molotow-Pakt kurz darauf von der Sowjetunion vereinnahmt. Das nationalsozialistische Besatzungsregime wütete grauenvoll. In deutschen Konzentrationslagern auf polnischem Boden wurden 6 Millionen Polen, ca. 16,5% der Gesamtbevölkerung, darunter 3 Millionen polnische Juden, ermordet. Nach Ende des zweiten Weltkrieges entstand auf einem nach Westen verschobenen Territorium mit der Volksrepublik Polen ein sowjetischer Vasallenstaat. Die Umwälzungen in Osteuropa, in Polen die Gewerkschaftsbewegung „Solidarność“ und die Wahl Karol Wojtyłas, eines polnischen Bischofs, zum Papst Johannes Paul II., dem Oberhaupt der mächtigen römisch-katholischen Kirche, führten schließlich 1989 zur Ablösung des kommunistischen Regimes. Freie Wahlen markierten den Beginn der Dritten Republik. 2004 trat Polen der Europäischen Union bei, was zur erfolgreichen wirtschaftlichen Entwicklung Polens in den Folgejahren maßgeblich beitrug. Derzeit wird Polen von der nationalkonservativen PiS-Partei regiert, die auf einen Obrigkeitsstaat hinarbeitet, jedoch wegen ihrer Sozialpolitik Zustimmung in großen Teilen der Bevölkerung genießt.
100 Jahre Neugründung Polens und die jüngsten politischen Verwerfungen sind Anlass, die Fotoserie „Polish Summer“ einem größeren Publikum zu präsentieren. Für diese Serie reiste Tomasz Lewandowski mehrfach durch seine polnische Heimat. Seine Fotografien zeigen einerseits Szenen aus dem Alltag, anderseits politisch und historisch relevante Orte und Objekte im Polen der Gegenwart. Weil er sowohl in Polen als auch in Deutschland zu Hause ist, kann er seine Heimat aus einer ganz eigenen Perspektive betrachten. Er sieht Polen gleichermaßen durch die Augen eines Fremden wie eines Einheimischen. Als Fotokünstler beschäftigt sich Lewandowski vor allem mit der soziologischen Dimension der Architektur. Es verwundert daher nicht, dass ein Großteil seiner Fotografien Gebäude, Straßen und Plätze zeigen. Dennoch bilden die Aufnahmen die sozialen Verhältnisse und die Lebensgewohnheiten der Polen auf einzigartige Weise ab. In ihnen drückt sich der wirtschaftlich-soziale Wandel ebenso aus wie die politisch-ideologischen Umbrüche der letzten Jahrzehnte. Es sind die Autobahnen und Einkaufszentren als Symbole des wirtschaftlichen Aufstiegs, die den Übergang Polens in die kapitalistische Welt des Westens markieren. Daneben finden sich die Relikte der sozialistischen Vergangenheit: anonyme Plattenbauten oder vernachlässigte Altstadtviertel. Und auch dort, wo nicht große Investoren oder der Staat ihre Hände im Spiel haben, wird erkennbar, wie sich in der Architektur die Wünsche und Träume der Polen manifestieren. Hier verkündet die Villa unmissverständlich den wirtschaftlichen Erfolg des Erbauers oder die feilgebotenen Gartenfiguren den Hang zu kleinbürgerlicher Idylle. Schließlich fordert die „Freizeit-Gesellschaft“ immer ausgefallenere Attraktionen, ein ausrangiertes Flugzeug wird zum Restaurant, mitten in der Agrarlandschaft wachsen stählerne Achterbahnen aus dem Boden. Andere liebenswerte Objekte, wie die typischen Kioske, verschwinden aus dem Stadtbild. Mit der Darstellung politisch und historisch relevanter Orte und Gedenkstätten konfrontiert der Fotograf den Betrachter mit Geschehnissen, die in Polen heute vielleicht eher verdrängt als wahrgenommen werden. In Zeiten eines neu aufkommenden Patriotismus gesteht man sich dunkle Kapitel der jüngeren Vergangenheit ungern ein, wie beispielsweise die Existenz von Arbeitslagern während der kommunistischen Herrschaft in den Jahren nach dem 2. Weltkrieg.
Tomasz Lewandowski 2018
Schon aufgrund der verwendeten Großformatkamera, die spontanes Fotografieren im Stil der „Street Photography“ kaum zulässt, sucht Tomasz Lewandowski dabei nicht den dramatischen Effekt - ihn interessieren vielmehr die mitunter scheinbar banalen Details, die sich erst bei genauerer Betrachtung als ganz und gar nicht banal erweisen. Gleichzeitig geht er seine Themen akribisch und bis in die zunächst kaum wahrnehmbaren Einzelheiten durchdacht an. Da ist beispielsweise der blaue Pool vor den in einiger Entfernung liegenden Baracken des von den deutschen Besatzern errichteten KZs Ausschwitz. Hat man die Bildinhalte erst einmal entschlüsselt geben sie auf subtile Weise Einblick in das Leben der Gegenwart wie in die jüngere Vergangenheit. Exemplarisch für die Intensität und Schärfe der aktuellen gesellschaftlichen Auseinandersetzungen steht das verstörende Billboard der Anti-Abtreibungskampagne, das Tomasz Lewandowski inmitten einer friedlichen Waldidylle im Tatra Gebirge ablichtet. Allen Anschein nach hat die katholische Kirche in Polen wie in keinem anderen Land Europas Einfluss auf Politik und Gesellschaft, wie sich vor allem aber nicht nur beim Thema Abtreibung zeigt. Die Institution mit ihrem Oberhaupt, dem Papst sind zweifellos sehr präsent in Polen.
Die Serie „Polish Summer“ bildet Polen auf stille und doch eindrückliche Weise ab, sowohl mit Bezug zur Gegenwart wie zur jüngeren Vergangenheit. Zu verdanken ist diese Bestandsaufnahme der beharrlichen Arbeit und den wachen Augen des Autores, Tomasz Lewandowski.
Text: J. Schmidt 09/2018
Die Serie „Polish Summer“ bildet Polen auf stille und doch eindrückliche Weise ab, sowohl mit Bezug zur Gegenwart wie zur jüngeren Vergangenheit. Zu verdanken ist diese Bestandsaufnahme der beharrlichen Arbeit und den wachen Augen des Autores, Tomasz Lewandowski.
Text: J. Schmidt 09/2018
Gegensätzlicher könnten die Motive kaum sein, die Lucas Oertel in seinen Werken zeigt: eine Jagdgesellschaft, Tiere zwischen üppigen Pflanzen, ein Typ, der entspannt auf einer grünen Wiese liegt und ein wilder Haufen Männer, offenbar mehr als angeheitert. Das exzessive Gelage im Bild „Open Air“ scheint aus dem Ruder zu laufen, die Szene droht zu kippen. Jeder sucht seinen Spaß in einem einzigen Durcheinander. Einige aus der feiernden Menge drohen erdrückt zu werden. In ihren Gesichtern meint man Schmerzensschreie zu erkennen, während drumherum ausgelassen gelacht und gejubelt wird.
Ganz im Gegensatz dazu stehen die Naturmotive. Der Mensch im Bild „draußen“ liegt entspannt und frei von Sorgen inmitten einer üppigen Natur. Lucas Oertel verortet diese Szene aus mehreren Einzelbildern in einer tropisch exotischen Umgebung. Affen, Papageien und ein Elefant umrahmen den glücklich im Gras liegenden Adam. Das perfekte Paradies, nur Eva lässt sich nicht blicken.
Ganz im Gegensatz dazu stehen die Naturmotive. Der Mensch im Bild „draußen“ liegt entspannt und frei von Sorgen inmitten einer üppigen Natur. Lucas Oertel verortet diese Szene aus mehreren Einzelbildern in einer tropisch exotischen Umgebung. Affen, Papageien und ein Elefant umrahmen den glücklich im Gras liegenden Adam. Das perfekte Paradies, nur Eva lässt sich nicht blicken.
Oertels Bilder führen in eine andere Welt und auch in eine andere Zeit. Im Holzrelief „Jäger“ kommt eine Jagdgesellschaft daher – mit Speeren bewaffnet und unbekleidet, weit entfernt von unserer Zivilisation. Die Speere durchbohren einen Tiger, der von Schmerz gezeichnet zu Boden sinkt. Erwehren sich die Jäger der Gefahr, der sie sich ausgesetzt sehen, oder greifen sie aggressiv und zerstörerisch in eine heile Welt ein? Lucas Oertel untersucht das Verhältnis des Menschen zu seiner Umwelt und zu seinen Mitmenschen, so, wie es ist, wie es war und wie es sein könnte. Fragen, mit denen wir uns heute mehr denn je konfrontiert sehen.
Text: J. Schmidt 07/2019
Text: J. Schmidt 07/2019
Newsha Tavakolian, Bahram Shabani, Behnam Sadiqi, Laurence Rasti, Hanna Darabi,
NavidReza Haghighi: "Inside Iran"
Kunsthaus Raskolnikow/Galerie 18.10. - 22.11.2019
veranstaltet vom FOTOFORUM Dresden in Kooperation mit Fotohof Salzburg
NavidReza Haghighi: "Inside Iran"
Kunsthaus Raskolnikow/Galerie 18.10. - 22.11.2019
veranstaltet vom FOTOFORUM Dresden in Kooperation mit Fotohof Salzburg
Mit der islamischen Revolution im Jahr 1979 wurde der Iran ein Gottesstaat. Dieser Staat polarisiert, im Land selbst wie in der ihn umgebenden Welt. Der Alltag der rund 80 Millionen Iraner wird rigide überwacht, Widersacher werden mundtot gemacht. Über die tatsächlichen gesellschaftlichen Verhältnisse im Iran dringen daher kaum Informationen - und noch weniger Bilder - nach außen. Journalisten und Künstler, darunter ganz besonders auch Fotografen, stehen unter ständigem Druck der Behörden. Wer in der Öffentlichkeit fotografiert macht sich per se verdächtig. Umso erstaunlicher ist es, dass es im Iran trotz aller Einschränkungen eine lebendige Fotoszene gibt, die sich zuletzt bei den Rencontres in Arles 2017 einem größeren Publikum präsentierte.
Aus naheliegenden Gründen beschäftigen sich die hier gezeigten Aufnahmen nicht vordergründig mit aktuellen politischen Auseinandersetzungen im Iran. Indem sie sich vorwiegend auf die private Lebenswirklichkeit beziehen, spiegeln sie gleichwohl subtil die autoritäre Realität des streng islamisch verfassten Staates.
Text: J. Schmidt 09/2019
Aus naheliegenden Gründen beschäftigen sich die hier gezeigten Aufnahmen nicht vordergründig mit aktuellen politischen Auseinandersetzungen im Iran. Indem sie sich vorwiegend auf die private Lebenswirklichkeit beziehen, spiegeln sie gleichwohl subtil die autoritäre Realität des streng islamisch verfassten Staates.
Text: J. Schmidt 09/2019
Newsha Tavakolian Tehran 2009
Bahram Shabani Tehran 2011
Behnam Sadiqi 2010-2012
Bahram Shabani Tehran 2011
Behnam Sadiqi 2010-2012
Phillip Hailperin zur Entstehung von »Passers-by«
Es ist das dritte Buch, das wir mit dem Fotografen Jürgen Schmidt umsetzen durften. Die herstellerische Herausforderung lag hier darin, dass keines der doppelseitigen Fotos durch den Faden gestört werden sollte (und natürlich sollte das Motiv vollständig sichtbar sein). Die Reihenfolge der Fotos stand jedoch fest. Zunächst hatten wir über ein Layflat-/Flatbook (auch als Panorama-Bindung bezeichnet) nachgedacht. Das erwies sich aufgrund von Format, gewünschtem Papier, Duoton-Offset-Druck und einer Auflage von 200 Stück jedoch als äußerst schwierig. Es gibt nicht viele Anbieter, die Flatbooks maschinell herstellen, denn die Maschinen dafür sind eine große Investition. Wer eine hat, möchte sie verständlicherweise möglichst optimal auslasten – da wird nur eine beschränkte Anzahl an Größen und Papier angeboten und als Druckverfahren gibt es 4-farbigen Druck mit Skalafarben. In Handarbeit hätten sich die Bögen zusammenkleben lassen – aber bei 84 Seiten ist das auch nicht die wirtschaftlichste Angelegenheit. Letztlich kamen wir zur Schweizer Broschur zurück, die wir schon beim vorhergehenden Band eingesetzt hatten. Sie lässt sich besonders gut aufschlagen. Mit DZA Druckerei zu Altenburg fanden wir schließlich eine Lösung mit einzelnen eingeklebten Seiten, die erforderlich waren, damit wirklich durch kein doppelseitiges Bild ein Faden geht.
Text: Phillip Hailperin (veröffentlicht in LinkedIn am 4. März 2020)
Phillip Hailperin arbeitet als Buchgestalter und Hersteller bei Hofmeister Stauder. Büchermacher sowie zappo [Agentur für Kommunikation]
Text: Phillip Hailperin (veröffentlicht in LinkedIn am 4. März 2020)
Phillip Hailperin arbeitet als Buchgestalter und Hersteller bei Hofmeister Stauder. Büchermacher sowie zappo [Agentur für Kommunikation]
Bogdan Konopka, Misha Kominek und Katarzyna Mazur: "Polen in meinen Augen.
Die Heimreise"
Kraszewski-Museum, Dresden, 16.09.2020 - 05.04.2021
Die Heimreise"
Kraszewski-Museum, Dresden, 16.09.2020 - 05.04.2021
Das Thema dieser Ausstellung ist „Emigration und Heimkehr“. Die Protagonisten Bogdan Konopka (geb. 1953), Misha Kominek (geb. 1971) und Katarzyna Mazur (geb. 1987) stehen stellvertretend für Millionen von Polen, die nach dem Beitritt Polens zur Europäischen Union ihre Heimat verlassen haben, um in Westeuropa ihr Glück zu suchen. Alle drei sind Fotografen. Sie verließen ihr Heimatland zu unterschiedlichen Zeiten, aus unterschiedlichen Gründen. Bogdan Konopka ging nach Frankreich, Misha Kominek nach Spanien, Katazyrna Mazur nach Deutschland. Im Verlauf der Zeit zieht es sie zurück nach Polen auf der Suche nach ihren Wurzeln. Da sie Fotografen sind, dokumentieren sie ihre „Heimreise“ als Bilderzählungen. Die Bilder zeigen vor allem Menschen, auch Orte, aber so gut wie keine Landschaften. Worin liegt also die Verbundenheit mit der Heimat, wo werden die Wurzeln gesucht? Entscheidend sind wohl die Menschen, die Identität als Polen.
Gleichzeitig bilden die Aufnahmen die Zeit ab, denn sie stammen aus unterschiedlichen Epochen. Die drei Fotografen sind damit auch Chronisten ihrer Zeit: Bogdan Konopkas SW-Aufnahmen zeigen Polen in den 1980-1990iger Jahren. Sie reichen zurück in die Zeit, in der in Polen das Kriegsrecht galt mit prekären wirtschaftlichen und sozialen Bedingungen. Misha Kominek ist im Jahr 1997 zunächst ebenfalls in schwarzweiß unterwegs und wechselt erst in den 2000er Jahren mit Polens neu gewonnener Prosperität im Zuge des EU-Beitritts zur Farbe. Mit Katarzyna Mazur 2013er Serie sind wir schließlich im Zeitalter der Digitalfotografie und mithin in der Gegenwart angekommen. Alle drei Fotografen durchstreifen zu ihrer Zeit das Land, treffen Landsleute und Familienmitglieder. Sie erlauben uns Außenstehenden einen Blick in die Lebenswelt unserer Nachbarn, heute und gestern.
Text: J. Schmidt 09/2020
Gleichzeitig bilden die Aufnahmen die Zeit ab, denn sie stammen aus unterschiedlichen Epochen. Die drei Fotografen sind damit auch Chronisten ihrer Zeit: Bogdan Konopkas SW-Aufnahmen zeigen Polen in den 1980-1990iger Jahren. Sie reichen zurück in die Zeit, in der in Polen das Kriegsrecht galt mit prekären wirtschaftlichen und sozialen Bedingungen. Misha Kominek ist im Jahr 1997 zunächst ebenfalls in schwarzweiß unterwegs und wechselt erst in den 2000er Jahren mit Polens neu gewonnener Prosperität im Zuge des EU-Beitritts zur Farbe. Mit Katarzyna Mazur 2013er Serie sind wir schließlich im Zeitalter der Digitalfotografie und mithin in der Gegenwart angekommen. Alle drei Fotografen durchstreifen zu ihrer Zeit das Land, treffen Landsleute und Familienmitglieder. Sie erlauben uns Außenstehenden einen Blick in die Lebenswelt unserer Nachbarn, heute und gestern.
Text: J. Schmidt 09/2020
Bogdan Konopka Trestno 1992
Misha Kominek Stalowa Wola 2005
Katarzyna Mazur Bieszczady 2013
Misha Kominek Stalowa Wola 2005
Katarzyna Mazur Bieszczady 2013
Interview mit Katarzyna Mazur (Berlin, 07.07.2020, gekürzt):
JS: Könntest du dich bitte kurz vorstellen ...
KM: Ich bin im Jahr 1987 in der Kleinstadt Koło geboren, die liegt etwa zwischen Posen und Warschau. Studiert habe ich in Thorn (Toruń) an der Nikolaus-Kopernikus- Universität, drei Jahre Germanistik, wobei ich das letzte Jahr schon in Potsdam war, wo ich an einem Erasmus-Austauschprogramm teilgenommen habe. Fotografie war eigentlich meine erste Berufswahl, aber damals gab es in Polen nicht so viele Studiengänge, wo man Fotografie studieren konnte und es war auch sehr schwer, einen Platz zu bekommen. Nach meinem Abitur habe ich mich zunächst in Posen (Poznań) an der Akademie der Künste und auch an der Filmhochschule in Lodz (Łódź) beworben. Es hat jedoch nicht geklappt. Dann meinten meine Eltern, dass ich etwas „Normales“ studieren und Fotografie als Hobby betreiben solle. Also habe ich mich für Germanistik entschieden, weil ich immer schon gerne Sprachen gelernt habe und meine Mutter Deutschlehrerin ist. Ich habe aber weiterhin fotografiert und als ich in Potsdam war, habe ich von der Ostkreuzschule in Berlin erfahren. Da gab es den Tag der offenen Tür. Ich bin einfach hingefahren und habe mir die Schule angeschaut. Das Profil hat mich sehr angesprochen und ich habe michentschieden, es mit Fotografie zu versuchen. Ich wurde an der Ostkreuzschule angenommen und gleich darauf bin ich nach Berlin gezogen. Das war im Jahr 2011.
JS: Du hast an der Ostkreuzschule in Berlin Fotografie studiert. Gab es dort einen Lehrer, der dich besonders geprägt hat?
KM: Das ist ohne Zweifel mein Dozent Ludwig Rauch, bei dem habe ich auch meine Abschlussarbeit gemacht. Das war auf jeden Fall eine gute Entscheidung.
JS: Welche Themen reizen dich? Mir scheint, dass du vor allem an Menschen interessiert bist.
KM: Ja, mich haben schon immer Außenseiter interessiert. Das war auch bei meiner Fotoserie über die Köhler in den Bieszczady ein wichtiges Motiv, so abgeschottet von der Gesellschaft zu leben, mitten im Wald, wo das nächste Dorf zehn Kilometer entfernt ist. Unbewusst habe ich mich schon vor der Fotografie mit dieser Frage auseinandergesetzt. Meine Bachelorarbeit habe ich über Andorra von Max Frisch geschrieben, wo es darum geht, wie anders man sein muss, um als Außenseiter betrachtet zu werden.
Vor ein paar Jahren hatte ich die Idee, meinen Nachbarn zu fotografieren. Der war türkischer Abstammung und hat als Bodyguard gearbeitet und auch vieles anderes gemacht, was nicht ganz legal war. Seine Art und Weise war fast aggressiv aber irgendwann habe ich gelernt, mit ihm umzugehen. Aber weil seine Welt so anders war als meine, hat er mich interessiert. Aber an dem Tag als ich ihn mit meiner Kamera besuchte, kam die Polizei und hat ihn festgenommen.
JS: Deine Serie „No One Loves You Like I Do“ hat dich in eine abgelegene Region der Bieszczady geführt. Wie kam es dazu?
KM: Das ist ein bisschen anders gelaufen, als ich mir das erhofft hatte. Es war nicht leicht zu den Leuten zu kommen. Mein Cousin hat mich zwar zu einer Gruppe von Köhlern gebracht, aber die waren sehr mißtrauisch mir gegenüber. Ich durfte nur die Öfen fotografieren, aber auf gar keinen Fall die Leute. Erst später erfuhr ich warum. Viele von diesen Leuten hatten eine kriminelle Vergangenheit und so war es für sie eine bewusste
Entscheidung, dass sie nicht fotografiert werden wollen. Deswegen musste ich erstmal meine Kamera wegpacken. Später sind wir dann noch zu einem anderen Mann gefahren, Olek, auch Köhler. Er ist auf einem meiner Bilder zu sehen. Er wohnt tatsächlich zehn Kilometer von einem Dorf entfernt, alleine mit einem Kollegen und einer Katze. Wir tranken selbst gemachten Kirschlikör und ich hatte zum ersten Mal das Gefühl, ein Teil dieser Wildnis zu sein. Das war vielleicht die erste Auseinandersetzung mit dem Begriff Heimat für mich.
JS: Du lebst seit vielen Jahren in Berlin. Hat sich dein Blick auf Polen dadurch verändert?
KM: Ich hoffe, ich habe diese Identitätskrise hinter mir. Vor zwei oder drei Jahren war ich schon an dem Punkt, wo ich dachte, wer bin ich, ich bin nicht da (in Polen) zu Hause und auch nicht ganz hier (in Berlin). Ich bin jetzt überall fremd. Aber inzwischen reicht mir das Wissen, dass ich Wurzeln habe. Ich finde es spannend wenn ich in Polen bin und ich fühle mich auch anders. Die Leute gucken mich auf der Straße an, weil ich - keine Ahnung - kurze Haare habe. Aber ich möchte nicht alles kritisch sehen sondern es ist auch schön, diese Unterschiede zu spüren. Und wenn man auf kluge Weise daraus lernen kann, dann ist es gut.
JS: Polen ist nach wie vor ein tief religiöses Land. Die Bilder polnischer Fotografen vermitteln das auch. Wie siehst du den gesellschaftlichen Einfluss der Kirche?
KM: Neulich war ich mal wieder in der Kirche - also ich musste. Die Messe war meinem Opa gewidmet. Ich habe mir wirklich alles genau angehört, was der Priester sagte, welche Worte er benutzte: Schuld, Sünder, Herzblut... Und ich war erstaunt, wie sehr die Sprache der katholischen Kirche mit solchen schweren Worten beladen ist. Das geht ziemlich unter die Haut. Ich habe mich - glaube ich - schon ein bisschen davon befreit.
Das Gespräch führte Jürgen Schmidt. Der Text ist redaktionell bearbeitet!
JS: Könntest du dich bitte kurz vorstellen ...
KM: Ich bin im Jahr 1987 in der Kleinstadt Koło geboren, die liegt etwa zwischen Posen und Warschau. Studiert habe ich in Thorn (Toruń) an der Nikolaus-Kopernikus- Universität, drei Jahre Germanistik, wobei ich das letzte Jahr schon in Potsdam war, wo ich an einem Erasmus-Austauschprogramm teilgenommen habe. Fotografie war eigentlich meine erste Berufswahl, aber damals gab es in Polen nicht so viele Studiengänge, wo man Fotografie studieren konnte und es war auch sehr schwer, einen Platz zu bekommen. Nach meinem Abitur habe ich mich zunächst in Posen (Poznań) an der Akademie der Künste und auch an der Filmhochschule in Lodz (Łódź) beworben. Es hat jedoch nicht geklappt. Dann meinten meine Eltern, dass ich etwas „Normales“ studieren und Fotografie als Hobby betreiben solle. Also habe ich mich für Germanistik entschieden, weil ich immer schon gerne Sprachen gelernt habe und meine Mutter Deutschlehrerin ist. Ich habe aber weiterhin fotografiert und als ich in Potsdam war, habe ich von der Ostkreuzschule in Berlin erfahren. Da gab es den Tag der offenen Tür. Ich bin einfach hingefahren und habe mir die Schule angeschaut. Das Profil hat mich sehr angesprochen und ich habe michentschieden, es mit Fotografie zu versuchen. Ich wurde an der Ostkreuzschule angenommen und gleich darauf bin ich nach Berlin gezogen. Das war im Jahr 2011.
JS: Du hast an der Ostkreuzschule in Berlin Fotografie studiert. Gab es dort einen Lehrer, der dich besonders geprägt hat?
KM: Das ist ohne Zweifel mein Dozent Ludwig Rauch, bei dem habe ich auch meine Abschlussarbeit gemacht. Das war auf jeden Fall eine gute Entscheidung.
JS: Welche Themen reizen dich? Mir scheint, dass du vor allem an Menschen interessiert bist.
KM: Ja, mich haben schon immer Außenseiter interessiert. Das war auch bei meiner Fotoserie über die Köhler in den Bieszczady ein wichtiges Motiv, so abgeschottet von der Gesellschaft zu leben, mitten im Wald, wo das nächste Dorf zehn Kilometer entfernt ist. Unbewusst habe ich mich schon vor der Fotografie mit dieser Frage auseinandergesetzt. Meine Bachelorarbeit habe ich über Andorra von Max Frisch geschrieben, wo es darum geht, wie anders man sein muss, um als Außenseiter betrachtet zu werden.
Vor ein paar Jahren hatte ich die Idee, meinen Nachbarn zu fotografieren. Der war türkischer Abstammung und hat als Bodyguard gearbeitet und auch vieles anderes gemacht, was nicht ganz legal war. Seine Art und Weise war fast aggressiv aber irgendwann habe ich gelernt, mit ihm umzugehen. Aber weil seine Welt so anders war als meine, hat er mich interessiert. Aber an dem Tag als ich ihn mit meiner Kamera besuchte, kam die Polizei und hat ihn festgenommen.
JS: Deine Serie „No One Loves You Like I Do“ hat dich in eine abgelegene Region der Bieszczady geführt. Wie kam es dazu?
KM: Das ist ein bisschen anders gelaufen, als ich mir das erhofft hatte. Es war nicht leicht zu den Leuten zu kommen. Mein Cousin hat mich zwar zu einer Gruppe von Köhlern gebracht, aber die waren sehr mißtrauisch mir gegenüber. Ich durfte nur die Öfen fotografieren, aber auf gar keinen Fall die Leute. Erst später erfuhr ich warum. Viele von diesen Leuten hatten eine kriminelle Vergangenheit und so war es für sie eine bewusste
Entscheidung, dass sie nicht fotografiert werden wollen. Deswegen musste ich erstmal meine Kamera wegpacken. Später sind wir dann noch zu einem anderen Mann gefahren, Olek, auch Köhler. Er ist auf einem meiner Bilder zu sehen. Er wohnt tatsächlich zehn Kilometer von einem Dorf entfernt, alleine mit einem Kollegen und einer Katze. Wir tranken selbst gemachten Kirschlikör und ich hatte zum ersten Mal das Gefühl, ein Teil dieser Wildnis zu sein. Das war vielleicht die erste Auseinandersetzung mit dem Begriff Heimat für mich.
JS: Du lebst seit vielen Jahren in Berlin. Hat sich dein Blick auf Polen dadurch verändert?
KM: Ich hoffe, ich habe diese Identitätskrise hinter mir. Vor zwei oder drei Jahren war ich schon an dem Punkt, wo ich dachte, wer bin ich, ich bin nicht da (in Polen) zu Hause und auch nicht ganz hier (in Berlin). Ich bin jetzt überall fremd. Aber inzwischen reicht mir das Wissen, dass ich Wurzeln habe. Ich finde es spannend wenn ich in Polen bin und ich fühle mich auch anders. Die Leute gucken mich auf der Straße an, weil ich - keine Ahnung - kurze Haare habe. Aber ich möchte nicht alles kritisch sehen sondern es ist auch schön, diese Unterschiede zu spüren. Und wenn man auf kluge Weise daraus lernen kann, dann ist es gut.
JS: Polen ist nach wie vor ein tief religiöses Land. Die Bilder polnischer Fotografen vermitteln das auch. Wie siehst du den gesellschaftlichen Einfluss der Kirche?
KM: Neulich war ich mal wieder in der Kirche - also ich musste. Die Messe war meinem Opa gewidmet. Ich habe mir wirklich alles genau angehört, was der Priester sagte, welche Worte er benutzte: Schuld, Sünder, Herzblut... Und ich war erstaunt, wie sehr die Sprache der katholischen Kirche mit solchen schweren Worten beladen ist. Das geht ziemlich unter die Haut. Ich habe mich - glaube ich - schon ein bisschen davon befreit.
Das Gespräch führte Jürgen Schmidt. Der Text ist redaktionell bearbeitet!
Interview mit Misha Kominek (Berlin, 16.07.2020, gekürzt):
JS: Könntest du dich bitte kurz vorstellen ...
MK: Ich bin 1971 in Knurow geboren, das ist ein kleiner Ort bei Gleiwitz (Gliwice), dort bin ich bis zur 5. Klasse zur Schule gegangen. 1982, ich war 11, sind meine Eltern nach West- Deutschland, genauer gesagt nach Frankfurt am Main, übergesiedelt.
JS: War das eine geplante Ausreise oder eher eine Flucht?
MK: Mein Vater, der an der Universität in Gleiwitz arbeitete, war zeitlich befristet als Austausch-Wissenschaftler am Max-Planck-Institut in Frankfurt tätig. Im Sommer 1982 haben wir ihn besucht und obwohl nicht geplant, sind wir da (in Frankfurt) geblieben. Wir haben die Wohnung in Polen hinterlassen, als würde man in den Urlaub fahren.
JS: Warum hast du dich der Fotografie zugewandt? Wie hat alles begonnen?
MK: Ich war mir nicht so sicher, mit welchem Studiengang ich nach dem Abitur fortfahren sollte. Im Alter von 16 oder 17 habe ich angefangen zu malen und erste Zeichenkurse belegt. Schließlich habe ich mich an der Hochschule für bildende Künste in Hamburg und auch an der Universität Frankfurt beworben, aber das hat nicht geklappt.
JS: Du hast dann in Barcelona Fotografie studiert. Warum gerade in Barcelona?
MK: Ich wollte unbedingt Spanisch lernen und bin deshalb nach Spanien gezogen. Dort hat sich der Gedanke entwickelt, mit Fotografie und Malerei irgendwie weiterzumachen. Ich habe mich für Barcelona entschieden, weil es nur dort einen staatlich anerkannten Studiengang für Fotografie gab. Das erste Jahr war eine Art Testphase mit relativ wenig Unterricht. In diesem Jahr galt es, eine Mappe zusammenzustellen, mit der man sich dann für das zweite Jahr qualifizieren konnte.
JS: Inwieweit hat dich dein Fotografiestudium künstlerisch geprägt?
MK: Künstlerisch war die Ausbildung nicht so tief gehend. Aber es war eine gute Schule. JS: Welche Gründe haben dich veranlasst von Barcelona nach Berlin zu gehen?
MK: Ich bin 2006/2007 auch deshalb nach Berlin gezogen, weil es so nah an Polen ist. Ich hatte in der Zeit vor 2007 schon oft in Polen fotografiert, Farbbilder, die dann zu „Second Journey Home“ führten. Daran wollte ich weiter arbeiten und dafür war Berlin eine bessere Basis als Barcelona.
JS: Deine frühere Serie „First Journey Home“ hatte dich nach Jahren in West-Deutschland und Spanien schon 1997 zurück nach Polen geführt. Wie kam es dazu?
MK: In Spanien war ich insgesamt 15 Jahre. In den Ferien oder zu Familienfeiern bin ich aber immer mal wieder in Polen gewesen. Meine Großmutter war der Mittelpunkt der Familie, wo sich alle getroffen haben. 1997, nach Abschluss meines Fotografiestudiums, bin ich dann zum ersten Mal alleine für eine längere Zeit durch Polen gefahren und dabei ist dieses erste Buch „Fist Journey Home“ entstanden. Ich habe versucht, Orte zu fotografieren, an die ich mich aus meiner Kindheit erinnern konnte. So hatte die Reise letztlich zum Ziel, Erinnerungen einzusammeln.
JS: Du hast - wie viele andere - dein Heimatland verlassen. Was verbindet dich heute mit Polen?
MK: Von einem ehemaligen Mitschüler habe ich erfahren, dass über die Hälfte meiner damaligen Klasse emigrierte. Aber diese Sehnsucht nach der Heimat, dem Ort, an dem meine Großmutter lebte, war schon immer irgendwie da.
JS: Warum und seit wann hast du wieder einen Wohnsitz in Polen?
MK: Es hat sich so entwickelt, dass ich immer mehr Leute in Polen kennenlernte, auch meine Frau, in Krakau. Der Ort, wo wir jetzt in Polen leben, ist die Heimat meiner Frau, Ostpolen, an der ukrainischen Grenze.
JS: Gibt es ein aktuelles Projekt, an dem du arbeitest? Was sind deine Pläne für die kommenden Jahre?
MK: Ich war mehrmals in China, neugierig, wie das Alltagsleben dort wirklich sein würde. Ich war vor allem in Shanghai und Beijing, aber auch in ländlichen Gebieten. Ich versuche daraus eine Serie zu machen. Aber „Second Journey Home“ ist natürlich auch relativ aktuell. Das will ich auf jeden Fall noch als Buch herausbringen.
Das Gespräch führte Jürgen Schmidt. Der Text ist redaktionell bearbeitet!
JS: Könntest du dich bitte kurz vorstellen ...
MK: Ich bin 1971 in Knurow geboren, das ist ein kleiner Ort bei Gleiwitz (Gliwice), dort bin ich bis zur 5. Klasse zur Schule gegangen. 1982, ich war 11, sind meine Eltern nach West- Deutschland, genauer gesagt nach Frankfurt am Main, übergesiedelt.
JS: War das eine geplante Ausreise oder eher eine Flucht?
MK: Mein Vater, der an der Universität in Gleiwitz arbeitete, war zeitlich befristet als Austausch-Wissenschaftler am Max-Planck-Institut in Frankfurt tätig. Im Sommer 1982 haben wir ihn besucht und obwohl nicht geplant, sind wir da (in Frankfurt) geblieben. Wir haben die Wohnung in Polen hinterlassen, als würde man in den Urlaub fahren.
JS: Warum hast du dich der Fotografie zugewandt? Wie hat alles begonnen?
MK: Ich war mir nicht so sicher, mit welchem Studiengang ich nach dem Abitur fortfahren sollte. Im Alter von 16 oder 17 habe ich angefangen zu malen und erste Zeichenkurse belegt. Schließlich habe ich mich an der Hochschule für bildende Künste in Hamburg und auch an der Universität Frankfurt beworben, aber das hat nicht geklappt.
JS: Du hast dann in Barcelona Fotografie studiert. Warum gerade in Barcelona?
MK: Ich wollte unbedingt Spanisch lernen und bin deshalb nach Spanien gezogen. Dort hat sich der Gedanke entwickelt, mit Fotografie und Malerei irgendwie weiterzumachen. Ich habe mich für Barcelona entschieden, weil es nur dort einen staatlich anerkannten Studiengang für Fotografie gab. Das erste Jahr war eine Art Testphase mit relativ wenig Unterricht. In diesem Jahr galt es, eine Mappe zusammenzustellen, mit der man sich dann für das zweite Jahr qualifizieren konnte.
JS: Inwieweit hat dich dein Fotografiestudium künstlerisch geprägt?
MK: Künstlerisch war die Ausbildung nicht so tief gehend. Aber es war eine gute Schule. JS: Welche Gründe haben dich veranlasst von Barcelona nach Berlin zu gehen?
MK: Ich bin 2006/2007 auch deshalb nach Berlin gezogen, weil es so nah an Polen ist. Ich hatte in der Zeit vor 2007 schon oft in Polen fotografiert, Farbbilder, die dann zu „Second Journey Home“ führten. Daran wollte ich weiter arbeiten und dafür war Berlin eine bessere Basis als Barcelona.
JS: Deine frühere Serie „First Journey Home“ hatte dich nach Jahren in West-Deutschland und Spanien schon 1997 zurück nach Polen geführt. Wie kam es dazu?
MK: In Spanien war ich insgesamt 15 Jahre. In den Ferien oder zu Familienfeiern bin ich aber immer mal wieder in Polen gewesen. Meine Großmutter war der Mittelpunkt der Familie, wo sich alle getroffen haben. 1997, nach Abschluss meines Fotografiestudiums, bin ich dann zum ersten Mal alleine für eine längere Zeit durch Polen gefahren und dabei ist dieses erste Buch „Fist Journey Home“ entstanden. Ich habe versucht, Orte zu fotografieren, an die ich mich aus meiner Kindheit erinnern konnte. So hatte die Reise letztlich zum Ziel, Erinnerungen einzusammeln.
JS: Du hast - wie viele andere - dein Heimatland verlassen. Was verbindet dich heute mit Polen?
MK: Von einem ehemaligen Mitschüler habe ich erfahren, dass über die Hälfte meiner damaligen Klasse emigrierte. Aber diese Sehnsucht nach der Heimat, dem Ort, an dem meine Großmutter lebte, war schon immer irgendwie da.
JS: Warum und seit wann hast du wieder einen Wohnsitz in Polen?
MK: Es hat sich so entwickelt, dass ich immer mehr Leute in Polen kennenlernte, auch meine Frau, in Krakau. Der Ort, wo wir jetzt in Polen leben, ist die Heimat meiner Frau, Ostpolen, an der ukrainischen Grenze.
JS: Gibt es ein aktuelles Projekt, an dem du arbeitest? Was sind deine Pläne für die kommenden Jahre?
MK: Ich war mehrmals in China, neugierig, wie das Alltagsleben dort wirklich sein würde. Ich war vor allem in Shanghai und Beijing, aber auch in ländlichen Gebieten. Ich versuche daraus eine Serie zu machen. Aber „Second Journey Home“ ist natürlich auch relativ aktuell. Das will ich auf jeden Fall noch als Buch herausbringen.
Das Gespräch führte Jürgen Schmidt. Der Text ist redaktionell bearbeitet!
Transgender sind häufig Opfer von Diskriminierung und Gewalt, weil sie so sind, wie sie sind. Allerdings sind in den letzten Jahren Geschlechter- und Sexualitätsrechte ein zunehmend sichtbarer und wichtiger Teil des Kampfes für bürgerliche Freiheiten geworden. Vor diesem Hintergrund zeigt das FOTOFORUM Porträts von Menschen, deren Geschlecht nicht den traditionellen Kategorien "männlich" oder "weiblich" zugeordnet werden können.
Text: J. Schmidt 10/2020
Text: J. Schmidt 10/2020
Paule Saviano: Tobias, Jeremy, Fipah 2016 ff
Interview with Paule Saviano (Online Video Talk: Dresden - New York City, 19.02.2021, shortened version):
JS: Paule, please introduce yourself. Who are you? What do you do?
PS: My name is Paule Saviano. I’m a photographer from New York City. I’ve been a professional photographer since I graduated from American University in 1996 where I studied Political Science and Visual Media.
The subjects I have photographed throughout my career have changed dramatically but the one constant has been that my photographs have always been about the person in front of the camera and not the photographer.
The past decade and a half my photographs have specialized in portraiture with strong historical and social links. I have a responsibility to photograph subjects I feel strongly about and want to learn more about. My photography concentrates on people who have been shaped by an event or circumstance that has left its impression on them and defined their life. I’m also committed to documenting the lives of people that society marginalizes. It’s my desire as an artist to confront aspects of our society that people would rather ignore.
JS: When and how did you start to have that idea of doing "Embrace" as a long term project?
PS: I began photographing transgender and gender non-binary people in 2016 and titled the project "Embrace". That summer there was an increasingly visible debate in America about civil rights for transgender and gender non-binary people, focusing especially on young transgender students. I have known transgender adults all my life but I had never given thought to when a transgender person realizes that the gender they identify with is different from the body they were born in. I was curious to find out when a transgender person would begin to transition to the gender they identify with and what that transition was like emotionally. I think many people concentrate on the physical aspects of transitioning, but I’m interested in the emotional part of it – the emotional process has to be fiercely intense.
Every time I pick up a camera it’s for the purpose of learning. I approached photographing transgender and gender non-binary people as an outsider. I’m not transgender or part of the LGBTQ+ community, even though growing-up in New York City I have been around the community all my life and I am an advocate for the community’s rights.
My goal is to photograph each person over a 15-20 year period to create a visual voice that documents their transition. It will be interesting, especially with the kids, to see how they navigate the journey over a long period of time.
JS: The title of your exhibition is "Embrace. What associations does this title trigger for you?
PS: I named this project Embrace because I wanted a title that could be interpreted in different ways and didn’t have just one literal meaning. I like titles that make you think and aren’t rigid. Embrace can be defined by accepting a person or an idea. It can also be used as a verb- by welcoming someone physically with a hug.
Embrace is meant to be a project that acknowledges, accepts, respects and welcomes people who are living outside the traditional gender norms.
JS: What provoked your interest in transgender people and what are you seeking to show by "Embrace"?
PS: When the audience views these photographs, I hope it makes them think deeply about the subject and that Embrace puts a face to what it’s like being transgender or gender non-binary. Transgender and gender non-conforming communities often live in secret or face increased discrimination and violence. My hope is that societies will begin to make the necessary changes to become educated about people living outside the traditional categories of gender and modify it’s legal system to make transitioning to the gender a person identifies with easier.
No one should have to seek a politician’s, judge’s, or the majority’s stamp of approval to live the lifestyle they desire. People with gender identities outside of the traditional categories shouldn’t have to live on the outskirts of a society that doesn’t care if they live or die. Through education and awareness it is possible for everyone to feel safe, recognized and respected.
JS: Can you tell us about how you found the people you photographed. How many attempts did it take to get access to people?
PS: It was difficult finding transgender people, especially children, to photograph. In most places transgender people still live in secret because of the discrimination or violence they experience. I began reaching out to transgender and gender non-binary support groups, and consulting with parents to build the necessary trust to explore these people’s lives. It was challenging to find willing participants who were comfortable sharing their often private identities but ultimately they understood that this was also an opportunity to communicate their stories. In some cases it took years to make progress.
It was also difficult because I’m not a member of LGBTQ+ community. Being a straight white cisgender (a person whose sense of personal identity and gender corresponds with their birth sex) male, I had to earn their trust by communicating my interests and what my intentions were with the photographs.
I photographed transgender and gender non-binary people from America, the Netherlands and the Czech Republic. I wanted to choose societies which had different views about gender identity. The Netherlands is a progressive society and has shown more openness compared to a country like the Czech Republic, which is still deeply rooted in traditional ideas of gender. As a result, the people I photographed in the Netherlands were much younger because they were allowed to transition without being shamed or discriminated against.
It took me two and a half years to find people in the Czech Republic to photograph because most transgender and gender non-binary people there transition secretly later in life or don’t transition at all because they are likely to face discrimination. It is also difficult to legally transition to another gender. In the Czech Republic I photographed all adults, except for one. It is rare for a child in the Czech Republic to transition because they are fearful of the backlash from the public or even their own family. After three years I was fortunate to find a transgender teenager, Tobíaš, who was brave enough to openly transition. Tobíaš began attending high school as a male, the gender he identifies as, a few months before I photographed him.
I also chose the people I photographed to demonstrate diversity in race, age, religion, economic situation and geographical location. The youngest person I photographed was five-years-old and the eldest 72-years-old. In America, I tried to highlight the experiences of transgender people of color and transgender people who are religious. I couldn’t tell a complete story about transgender and gender non-binary people without highlighting the dangers transgender people of color experience. Transgender females of color experience extremely elevated rates of violence, murder and suicide than any other demographic, and those rates continue to rise.
One of the people I photographed was Joniece, an American transgender woman of color who began to secretly transition at the end of high school. She was fearful of transitioning because she was raised in a devote Jehovah's Witness family without a stable support system. After high school she revealed to her mother that she was transgender. She was thrown out of her home and ex-communicated from the religion. She began to openly transition shortly after and is living without the support of her family.
It was important to show that transgender and gender non-binary people weren’t confined to just one demographic. They are present in all cultures. I’m also in the process of photographing transgender and gender non-binary people living in Japan. My goal is to keep expanding the project to include people from many cultures.
JS: Why do you think people agree to be photographed?
PS: I think some of them saw it as an opportunity to communicate their stories to help better educate society about what being gender non-binary or transgender is. Others felt they were at a moment in their life that they felt confident enough to see who they really are after or while they transitioned to the gender they identified with. The photographs gave them a visual voice to determine how they want to be portrayed. I made it clear that the photograph was about them. I also used quotations from our conversations that are their exact words. It was another way of making sure the story was coming directly from them without bias.
JS: What would you like visitors to take away from the „Embrace“ exhibition?
PS: I hope the audience can see these portraits and learn about the struggles that transgender, gender non-binary people are confronted with and the fact that they just want to live a happy, productive life, just like anybody else. They’re not threatening anybody else’s survival or lifestyle – they’re just looking to be recognized and to be part of a society that accepts them. Transgender and gender non-binary people are not asking for anything special; they desire to be afforded the same rights that everyone else is afforded.
Everything starts with education and information. The lack of understanding is always the easiest path to prejudice, so if we understood a little bit more about what transgender and gender non-conformity is it would go a long way. Informing the public of the facts about what it means to be transgender or gender non-binary will be beneficial to remove the stigmas and false perceptions that lead to the discrimination and outcast of transgender people from society.
I’d also like for the audience to consider that in some places an exhibition like this would be illegal. It’s a troublesome reality that living outside the traditional spectrum of gender is considered illegal in certain places and the promotion of these lifestyles are also considered criminal in many countries.
JS: Why did you decide to leave the United States for taking photos of transgender people in Europe too?
PS: It was important to me that I demonstrate that there are people living outside the traditional norms of gender conformity everywhere. Gender non-binary and transgender people have always been part of every society. I think there is a common misconception that these communities only exist in large cosmopolitan cities that are often characterized as being socially progressive. I photographed a broad spectrum of transgender and gender non-binary people in the Netherlands and Czech Republic who came from different social demographics and lived in rural and urban areas.
As I photographed, I’ve realized that everyone’s experience was distinct, and the culture they lived in influenced how difficult it was. While many societies are reevaluating how they understand and represent gender, others are steadfastly intolerant and reactionary.
My impression is that transgender people who transition to the gender they identify with, in a supportive and well-informed environment, have a healthier and more productive life. Transgender people who live in cultures, like in the Netherlands, which offer counseling and medical treatment at young ages will benefit physically and emotionally.
I entered this experience with an open mind. But it took time to realize that the traditional viewpoints of gender are very rooted - even in myself. The project began when I photographed a five-year-old transgender boy named Bryan. He was dressed in a navy blue suit, a dapper bow tie and only spoke about superheros. My instinct was because Bryan dressed in a blue suit, had short hair and spoke about boyish interests, that it was simple: Bryan was a boy.
As I met more transgender and gender non-binary people it was evident this was contradictory because I was reinforcing gender stereotypes, even without realizing it. I had photographed transgender girls who still intensely followed sports they were interested in prior to their transition. Emphasizing gender stereotypes, in order to validate transgender and gender non-binary people, is precarious. They do not need to succumb as a stereotypical male or female to be accepted in society as the gender they identify with. Gender is so much more complex than the “shortcuts” of societal norms like dress, hobbies etc. And it's crucial to remember that when talking about transgender identities as well.
JS: Traveling is obviously an important part of your life and practice. Could you explain your relationship with Europe and Japan?
PS: Traveling has become a major characteristic of the experiences with my camera. For the past decade and a half the creative process almost always involves me going somewhere far away. Taking a photograph in New York or in America is a foreign feeling for me.
JS: Now you can’t travel. Did that change your approach? What are you photographing in these days of lockdown?
PS: The pandemic has been difficult in many ways. My photographs are about people and for over a year we’ve been told to isolate ourselves from each other. It’s taken away my greatest interest and passion. I have never been interested in creating images without people.
I’ve only photographed one portrait for Embrace since the pandemic began. It was done outside with an abundance of caution. I felt it was important to continue documenting because the pandemic has had an understated emotional impact on many people. There needs to be a record of this unforgetable time. Hiding, or hibernating, is not a choice for me.
During the summer I photographed assignments covering the social justice protests and since the early days of the pandemic I was photographing the changing cityscape of New York. I've forced myself to continue documenting the city during the pandemic. It's been a struggle creatively because almost all of my photographs since March 2020 are devoid of life.
At the beginning of the pandemic the streets were abandoned and the city was paralyzed with fear. That shifted in the summer to a sense of responsibility to take to the streets and protest social injustice and police brutality. Recently there seems to be a feeling of resilience in the city. The fear of the virus has been steadily overtaken by economic distress that has left much of the city desolate.
In famous areas of New York, like Broadway, the only theater lights shining are from lonely marquees that vow to reopen once the pandemic is tamed. Steps from Times Square, Broadway resembles a sleepy ghost town with once grand theaters now abandoned and random moving trucks accumulating stacks of parking tickets. Other areas, such as SOHO which were filled with posh fashion boutiques and art museums, now feel like a forgotten Purgatory in the armpit of the city. Sixth Avenue would normally be crowded with residents and tourists criss crossing between Greenwich Village, SOHO and the East Village to enjoy the amplified social life that the holidays bring. The streets are now lonesome with an occasional taxi gliding down the barren avenue. The silence is deeply painful. These barren cityscape's that I've been photographing aren't the type of photographs that inspire me. I long for the day I can intensely photograph people again.
The interview was conducted by Jürgen Schmidt.
JS: Paule, please introduce yourself. Who are you? What do you do?
PS: My name is Paule Saviano. I’m a photographer from New York City. I’ve been a professional photographer since I graduated from American University in 1996 where I studied Political Science and Visual Media.
The subjects I have photographed throughout my career have changed dramatically but the one constant has been that my photographs have always been about the person in front of the camera and not the photographer.
The past decade and a half my photographs have specialized in portraiture with strong historical and social links. I have a responsibility to photograph subjects I feel strongly about and want to learn more about. My photography concentrates on people who have been shaped by an event or circumstance that has left its impression on them and defined their life. I’m also committed to documenting the lives of people that society marginalizes. It’s my desire as an artist to confront aspects of our society that people would rather ignore.
JS: When and how did you start to have that idea of doing "Embrace" as a long term project?
PS: I began photographing transgender and gender non-binary people in 2016 and titled the project "Embrace". That summer there was an increasingly visible debate in America about civil rights for transgender and gender non-binary people, focusing especially on young transgender students. I have known transgender adults all my life but I had never given thought to when a transgender person realizes that the gender they identify with is different from the body they were born in. I was curious to find out when a transgender person would begin to transition to the gender they identify with and what that transition was like emotionally. I think many people concentrate on the physical aspects of transitioning, but I’m interested in the emotional part of it – the emotional process has to be fiercely intense.
Every time I pick up a camera it’s for the purpose of learning. I approached photographing transgender and gender non-binary people as an outsider. I’m not transgender or part of the LGBTQ+ community, even though growing-up in New York City I have been around the community all my life and I am an advocate for the community’s rights.
My goal is to photograph each person over a 15-20 year period to create a visual voice that documents their transition. It will be interesting, especially with the kids, to see how they navigate the journey over a long period of time.
JS: The title of your exhibition is "Embrace. What associations does this title trigger for you?
PS: I named this project Embrace because I wanted a title that could be interpreted in different ways and didn’t have just one literal meaning. I like titles that make you think and aren’t rigid. Embrace can be defined by accepting a person or an idea. It can also be used as a verb- by welcoming someone physically with a hug.
Embrace is meant to be a project that acknowledges, accepts, respects and welcomes people who are living outside the traditional gender norms.
JS: What provoked your interest in transgender people and what are you seeking to show by "Embrace"?
PS: When the audience views these photographs, I hope it makes them think deeply about the subject and that Embrace puts a face to what it’s like being transgender or gender non-binary. Transgender and gender non-conforming communities often live in secret or face increased discrimination and violence. My hope is that societies will begin to make the necessary changes to become educated about people living outside the traditional categories of gender and modify it’s legal system to make transitioning to the gender a person identifies with easier.
No one should have to seek a politician’s, judge’s, or the majority’s stamp of approval to live the lifestyle they desire. People with gender identities outside of the traditional categories shouldn’t have to live on the outskirts of a society that doesn’t care if they live or die. Through education and awareness it is possible for everyone to feel safe, recognized and respected.
JS: Can you tell us about how you found the people you photographed. How many attempts did it take to get access to people?
PS: It was difficult finding transgender people, especially children, to photograph. In most places transgender people still live in secret because of the discrimination or violence they experience. I began reaching out to transgender and gender non-binary support groups, and consulting with parents to build the necessary trust to explore these people’s lives. It was challenging to find willing participants who were comfortable sharing their often private identities but ultimately they understood that this was also an opportunity to communicate their stories. In some cases it took years to make progress.
It was also difficult because I’m not a member of LGBTQ+ community. Being a straight white cisgender (a person whose sense of personal identity and gender corresponds with their birth sex) male, I had to earn their trust by communicating my interests and what my intentions were with the photographs.
I photographed transgender and gender non-binary people from America, the Netherlands and the Czech Republic. I wanted to choose societies which had different views about gender identity. The Netherlands is a progressive society and has shown more openness compared to a country like the Czech Republic, which is still deeply rooted in traditional ideas of gender. As a result, the people I photographed in the Netherlands were much younger because they were allowed to transition without being shamed or discriminated against.
It took me two and a half years to find people in the Czech Republic to photograph because most transgender and gender non-binary people there transition secretly later in life or don’t transition at all because they are likely to face discrimination. It is also difficult to legally transition to another gender. In the Czech Republic I photographed all adults, except for one. It is rare for a child in the Czech Republic to transition because they are fearful of the backlash from the public or even their own family. After three years I was fortunate to find a transgender teenager, Tobíaš, who was brave enough to openly transition. Tobíaš began attending high school as a male, the gender he identifies as, a few months before I photographed him.
I also chose the people I photographed to demonstrate diversity in race, age, religion, economic situation and geographical location. The youngest person I photographed was five-years-old and the eldest 72-years-old. In America, I tried to highlight the experiences of transgender people of color and transgender people who are religious. I couldn’t tell a complete story about transgender and gender non-binary people without highlighting the dangers transgender people of color experience. Transgender females of color experience extremely elevated rates of violence, murder and suicide than any other demographic, and those rates continue to rise.
One of the people I photographed was Joniece, an American transgender woman of color who began to secretly transition at the end of high school. She was fearful of transitioning because she was raised in a devote Jehovah's Witness family without a stable support system. After high school she revealed to her mother that she was transgender. She was thrown out of her home and ex-communicated from the religion. She began to openly transition shortly after and is living without the support of her family.
It was important to show that transgender and gender non-binary people weren’t confined to just one demographic. They are present in all cultures. I’m also in the process of photographing transgender and gender non-binary people living in Japan. My goal is to keep expanding the project to include people from many cultures.
JS: Why do you think people agree to be photographed?
PS: I think some of them saw it as an opportunity to communicate their stories to help better educate society about what being gender non-binary or transgender is. Others felt they were at a moment in their life that they felt confident enough to see who they really are after or while they transitioned to the gender they identified with. The photographs gave them a visual voice to determine how they want to be portrayed. I made it clear that the photograph was about them. I also used quotations from our conversations that are their exact words. It was another way of making sure the story was coming directly from them without bias.
JS: What would you like visitors to take away from the „Embrace“ exhibition?
PS: I hope the audience can see these portraits and learn about the struggles that transgender, gender non-binary people are confronted with and the fact that they just want to live a happy, productive life, just like anybody else. They’re not threatening anybody else’s survival or lifestyle – they’re just looking to be recognized and to be part of a society that accepts them. Transgender and gender non-binary people are not asking for anything special; they desire to be afforded the same rights that everyone else is afforded.
Everything starts with education and information. The lack of understanding is always the easiest path to prejudice, so if we understood a little bit more about what transgender and gender non-conformity is it would go a long way. Informing the public of the facts about what it means to be transgender or gender non-binary will be beneficial to remove the stigmas and false perceptions that lead to the discrimination and outcast of transgender people from society.
I’d also like for the audience to consider that in some places an exhibition like this would be illegal. It’s a troublesome reality that living outside the traditional spectrum of gender is considered illegal in certain places and the promotion of these lifestyles are also considered criminal in many countries.
JS: Why did you decide to leave the United States for taking photos of transgender people in Europe too?
PS: It was important to me that I demonstrate that there are people living outside the traditional norms of gender conformity everywhere. Gender non-binary and transgender people have always been part of every society. I think there is a common misconception that these communities only exist in large cosmopolitan cities that are often characterized as being socially progressive. I photographed a broad spectrum of transgender and gender non-binary people in the Netherlands and Czech Republic who came from different social demographics and lived in rural and urban areas.
As I photographed, I’ve realized that everyone’s experience was distinct, and the culture they lived in influenced how difficult it was. While many societies are reevaluating how they understand and represent gender, others are steadfastly intolerant and reactionary.
My impression is that transgender people who transition to the gender they identify with, in a supportive and well-informed environment, have a healthier and more productive life. Transgender people who live in cultures, like in the Netherlands, which offer counseling and medical treatment at young ages will benefit physically and emotionally.
I entered this experience with an open mind. But it took time to realize that the traditional viewpoints of gender are very rooted - even in myself. The project began when I photographed a five-year-old transgender boy named Bryan. He was dressed in a navy blue suit, a dapper bow tie and only spoke about superheros. My instinct was because Bryan dressed in a blue suit, had short hair and spoke about boyish interests, that it was simple: Bryan was a boy.
As I met more transgender and gender non-binary people it was evident this was contradictory because I was reinforcing gender stereotypes, even without realizing it. I had photographed transgender girls who still intensely followed sports they were interested in prior to their transition. Emphasizing gender stereotypes, in order to validate transgender and gender non-binary people, is precarious. They do not need to succumb as a stereotypical male or female to be accepted in society as the gender they identify with. Gender is so much more complex than the “shortcuts” of societal norms like dress, hobbies etc. And it's crucial to remember that when talking about transgender identities as well.
JS: Traveling is obviously an important part of your life and practice. Could you explain your relationship with Europe and Japan?
PS: Traveling has become a major characteristic of the experiences with my camera. For the past decade and a half the creative process almost always involves me going somewhere far away. Taking a photograph in New York or in America is a foreign feeling for me.
JS: Now you can’t travel. Did that change your approach? What are you photographing in these days of lockdown?
PS: The pandemic has been difficult in many ways. My photographs are about people and for over a year we’ve been told to isolate ourselves from each other. It’s taken away my greatest interest and passion. I have never been interested in creating images without people.
I’ve only photographed one portrait for Embrace since the pandemic began. It was done outside with an abundance of caution. I felt it was important to continue documenting because the pandemic has had an understated emotional impact on many people. There needs to be a record of this unforgetable time. Hiding, or hibernating, is not a choice for me.
During the summer I photographed assignments covering the social justice protests and since the early days of the pandemic I was photographing the changing cityscape of New York. I've forced myself to continue documenting the city during the pandemic. It's been a struggle creatively because almost all of my photographs since March 2020 are devoid of life.
At the beginning of the pandemic the streets were abandoned and the city was paralyzed with fear. That shifted in the summer to a sense of responsibility to take to the streets and protest social injustice and police brutality. Recently there seems to be a feeling of resilience in the city. The fear of the virus has been steadily overtaken by economic distress that has left much of the city desolate.
In famous areas of New York, like Broadway, the only theater lights shining are from lonely marquees that vow to reopen once the pandemic is tamed. Steps from Times Square, Broadway resembles a sleepy ghost town with once grand theaters now abandoned and random moving trucks accumulating stacks of parking tickets. Other areas, such as SOHO which were filled with posh fashion boutiques and art museums, now feel like a forgotten Purgatory in the armpit of the city. Sixth Avenue would normally be crowded with residents and tourists criss crossing between Greenwich Village, SOHO and the East Village to enjoy the amplified social life that the holidays bring. The streets are now lonesome with an occasional taxi gliding down the barren avenue. The silence is deeply painful. These barren cityscape's that I've been photographing aren't the type of photographs that inspire me. I long for the day I can intensely photograph people again.
The interview was conducted by Jürgen Schmidt.
Paule Saviano: "From Above - Überlebende der Bombenkriege des zweiten Weltkrieges"
Kunsthaus Raskolnikow/Galerie, Dresden, 12.02. - 23.04.2022
Kunsthaus Raskolnikow/Galerie, Dresden, 12.02. - 23.04.2022
Seit 2008 sucht der New Yorker Fotograf Paule Saviano Menschen, die die Bombenangriffe des Zweiten Weltkriegs überlebt haben. In diesem Projekt, dem er den Titel "From Above“ gab, sind mittlerweile Porträts u.a. aus Coventry, Tokio, Wielun, Rotterdam sowie aus Hiroshima und Nagasaki entstanden.
Im Februar 2010 begann Saviano Kontakt zu Überlebenden der Brandbombenangriffe auf Dresden zu suchen. Sein Brief erreichte die Zeitzeugin Nora Lang, die zu diesem Zeitpunkt mit zahlreichen Überlebenden der alliierten Luftangriffe auf Dresden in Verbindung stand.
Im Mai 2010 besuchte er dann unsere Stadt. Bei dieser Reise hat Saviano zunächst 11 Porträts dieser Menschen aufnehmen können und ihre Erinnerungen aufgezeichnet. Bereits im Februar 2011 kehrte er nach Dresden zurück, um diese Fotos in einer kleinen Veranstaltung mit den Überlebenden zu präsentieren und fotografierte weitere 9 Zeitzeugen aus Dresden und 2 aus Wielun (Polen). Seitdem besuchte er unsere Stadt immer wieder, weitere Porträts kamen hinzu.
Die Porträtfotografie des New Yorkers konzentriert sich auf Menschen, deren Leben durch ein Ereignis oder einen Umstand geprägt wurden. Wie sie ihr Leben danach gelebt haben, ist sein primäres Interesse. Denn die Geschichte des Krieges wird oft mit Statistiken und Fotos der Zerstörungen präsentiert - für Paule Saviano fehlt dabei der menschliche Aspekt. Er möchte denen, die unter den Trümmern lagen und von den Feuerstürmen verfolgt wurden, ein Gesicht geben. Die emotionalen Narben des Krieges verschwinden nicht - auch wenn der Krieg zu Ende ist. Sie sind dauerhaft. Mit Nora Lang steht Saviano bis heute in Verbindung.
Die Schauvitrinen in der Gewandhausstraße in Dresden sind aus den 1950er Jahren und wurden als Ort der Ausstellung gewählt, um die Fotografien in das Zentrum der damaligen Zerstörungen zu stellen. Gleichzeitig hoffen die Veranstalter, damit eine große Öffentlichkeit zu erreichen.
Text: J. Schmidt 02/2022
Im Februar 2010 begann Saviano Kontakt zu Überlebenden der Brandbombenangriffe auf Dresden zu suchen. Sein Brief erreichte die Zeitzeugin Nora Lang, die zu diesem Zeitpunkt mit zahlreichen Überlebenden der alliierten Luftangriffe auf Dresden in Verbindung stand.
Im Mai 2010 besuchte er dann unsere Stadt. Bei dieser Reise hat Saviano zunächst 11 Porträts dieser Menschen aufnehmen können und ihre Erinnerungen aufgezeichnet. Bereits im Februar 2011 kehrte er nach Dresden zurück, um diese Fotos in einer kleinen Veranstaltung mit den Überlebenden zu präsentieren und fotografierte weitere 9 Zeitzeugen aus Dresden und 2 aus Wielun (Polen). Seitdem besuchte er unsere Stadt immer wieder, weitere Porträts kamen hinzu.
Die Porträtfotografie des New Yorkers konzentriert sich auf Menschen, deren Leben durch ein Ereignis oder einen Umstand geprägt wurden. Wie sie ihr Leben danach gelebt haben, ist sein primäres Interesse. Denn die Geschichte des Krieges wird oft mit Statistiken und Fotos der Zerstörungen präsentiert - für Paule Saviano fehlt dabei der menschliche Aspekt. Er möchte denen, die unter den Trümmern lagen und von den Feuerstürmen verfolgt wurden, ein Gesicht geben. Die emotionalen Narben des Krieges verschwinden nicht - auch wenn der Krieg zu Ende ist. Sie sind dauerhaft. Mit Nora Lang steht Saviano bis heute in Verbindung.
Die Schauvitrinen in der Gewandhausstraße in Dresden sind aus den 1950er Jahren und wurden als Ort der Ausstellung gewählt, um die Fotografien in das Zentrum der damaligen Zerstörungen zu stellen. Gleichzeitig hoffen die Veranstalter, damit eine große Öffentlichkeit zu erreichen.
Text: J. Schmidt 02/2022
Paule Saviano, aus der Serie "From Above" 2008 ff.
Ruth Unger, Lucas Oertel, Jürgen Schmidt: "Persona"
Kunsthaus Raskolnikow/Galerie, Dresden, 27.05. - 22.07.2022
Kunsthaus Raskolnikow/Galerie, Dresden, 27.05. - 22.07.2022
"Persona" bezeichnet im antiken Rom Theatermaske und -rolle sowie, daraus abgeleitet, unter anderem die bereichsspezifische soziale Rolle etwa vor Gericht, als Amtsinhaber oder Familienmitglied. Wer nur so tut, als würde er den entsprechenden Erwartungen gerecht werden, dem galt es, sprichwörtlich "die persona vom Kopf herunterzureißen". Sein wahrer Charakter jenseits aller heuchlerischen Maskierung wäre damit bloßgelegt. Die heute vor allem in Philosophie und Recht gängige gegenteilige Bedeutung von "Person" nimmt "persona" im Laufe der Jahrhunderte seit der Spätantike an: "Person" steht demnach gerade nicht für Rolle, Typus oder sonst einer allgemeinen Bestimmung, sondern für ein (einzigartiges und einmaliges) Individuum, sofern es mit Verstand, kontinuierlichem Selbstbewusstsein, Aktivität, Moralität und Verantwortung ausgestattet und als solches anerkannt ist.
Die Spannung zwischen individueller Person und typisierender persona bleibt uns künstlerisch aufgegeben, insbesondere seit sich barocke Bildniskunst aufmacht, nicht nur persönliche Eigenheit zu erkunden, sondern auch die individuellen Möglichkeiten eines solchen Erkundens zu erkunden. So demaskiert die Moderne ausgerechnet ins Maskenhafte, um existentielle Grundbefindlichkeiten wie Angst zu enthüllen. Andererseits dient das Porträt seit je der Repräsentation und droht, das Individuum hinter Imageformeln und sonstigen Verortungen in dichten Beziehungsgeflechten zu ver-stellen. Gegen Rousseaus Anliegen, jede solche soziale Maskerade politisch zu überwinden, fordert Helmuth Plessner eine Kultur der Maske gerade zum Schutz der Individualität vor totalitären Tendenzen. Aktuell eröffnet neben den bekannten allgegenwärtigen Systemzwängen das unerreichbare Ziel, sich als online persona authentisch zur Aufführung zu bringen, neue Gelegenheiten, produktiv zu scheitern. Können wir gar nicht anders, als im Zwiespalt persona-Person zu leben und uns zu denken? Kann ein solches Leben gelingen?
Text: Dr. Alexander Wiehart 05/2022
Die Spannung zwischen individueller Person und typisierender persona bleibt uns künstlerisch aufgegeben, insbesondere seit sich barocke Bildniskunst aufmacht, nicht nur persönliche Eigenheit zu erkunden, sondern auch die individuellen Möglichkeiten eines solchen Erkundens zu erkunden. So demaskiert die Moderne ausgerechnet ins Maskenhafte, um existentielle Grundbefindlichkeiten wie Angst zu enthüllen. Andererseits dient das Porträt seit je der Repräsentation und droht, das Individuum hinter Imageformeln und sonstigen Verortungen in dichten Beziehungsgeflechten zu ver-stellen. Gegen Rousseaus Anliegen, jede solche soziale Maskerade politisch zu überwinden, fordert Helmuth Plessner eine Kultur der Maske gerade zum Schutz der Individualität vor totalitären Tendenzen. Aktuell eröffnet neben den bekannten allgegenwärtigen Systemzwängen das unerreichbare Ziel, sich als online persona authentisch zur Aufführung zu bringen, neue Gelegenheiten, produktiv zu scheitern. Können wir gar nicht anders, als im Zwiespalt persona-Person zu leben und uns zu denken? Kann ein solches Leben gelingen?
Text: Dr. Alexander Wiehart 05/2022
Ein Thema, verschiedene Medien. Fotografie, Malerei, Skulptur und Plastik fragen nach dem Gesicht, seiner Lesbarkeit, seiner Maskenhaftigkeit. Wann sprechen wir von einem Gesicht? Genügt ein Oval mit drei Löchern? Ruth Unger sucht mit plastischen Mitteln nach einer Minimalform. Ihre Serie „One Mask. One Day“ erprobt das formale Schema in immer neuen Variationen. Mit verschiedenen Materialien und Techniken – vor allem aber mit gestalterischem Witz – analysiert Unger das Gesicht als Zeichensystem, dem sie überraschende Ausdruckswerte abgewinnt. Im Rekurs auf eine der ältesten Bildformen überhaupt erinnert sie an die Dialektik der Maske wie des Gesichts, Identität zu behaupten und sie zugleich zu verbergen. Für Lucas Oertel ist es nicht das Oval, sondern der unförmige Kreis, der das Grundschema seiner gemalten Gesichter ausmacht. Ebenso amorph sind die Öffnungen der Maloberfläche, in denen Augen, Nase und Mund erscheinen, die aus farbigen Zeitschriften stammen. Durch ihren fotografischen Ursprung stehen sie in irritierendem Kontrast zur geradezu tachistischen Peinture, die weniger an ein feines Inkarnat als vielmehr an offenes Fleisch denken lässt. Doch trotz ihrer maskenhaften Ungestalt erscheinen die stets das Bildformat füllenden Gesichter als empfindsam, verletzlich, zart, bisweilen fast ekstatisch: eine feine Registratur der Gefühle. Der Fotograf Jürgen Schmidt nähert sich dem Gesicht auf konventionelle wie experimentelle Weise. Im ganzfigurigen Porträt erfasst er es als Kulminationspunkt der Gesamtperformanz des Körpers an einem spezifischen Ort; im Studio-Bruststück fokussiert er, fast wie im Scherenschnitt, die charakteristische Silhouette. Seine Solarisationen beschwören dagegen die Macht der Verfremdung, die mit den Prozessen in der Dunkelkammer einhergeht: Verkehrung, Spiegelung, Montage, Überblendung. Nach alter Vorstellung zieht die Fotografie den Porträtierten ein Häutchen ab, eine Maske ihrer selbst. Schmidts Arbeiten erkunden, inwieweit sie ihnen tatsächlich passt.
Text: Dr. Bertram Kaschek 05/2022
Text: Dr. Bertram Kaschek 05/2022
Jürgen Schmidt, Ruth Unger, Lucas Oertel: "Persona/Einladungskarte" 2022
Der Titel „Anna Konda“ verweist auf den Female Fightclub in Berlin-Marzahn, wo die Aufnahmen entstanden. Kampfsport ist zwar nach wie vor eine Männerdomäne, erfährt aber zunehmende Zulauf von Frauen, die im freien Kampf zu innerer Stärke finden wollen.
Katarzyna Mazur, aus der Serie "ANNA KONDA" 2014
Künstlergespräch mit Hansgert Lambers (Fotoforum Dresden, 20.01.2023):
HL: Hansgert Lambers
KW: Karen Weinert
JS: Jürgen Schmidt
JS: Das Forum für zeitgenössische Fotografie Dresden präsentierte vom 24. November 2022 bis 20. Januar 2023 einen Ausschnitt aus der Retrospektive des fotografischen Lebenswerks von Hansgert Lambers, die vom 10. Juni bis 7. August 2022 unter dem Titel „Verweilter Augenblick“ im Haus am Kleistpark in Berlin gezeigt wurde. Dem Kurator der Berliner Ausstellung, Herrn Matthias Reichelt, ist herzlich zu danken, dass ein Teil der Arbeiten im Anschluss in Dresden gezeigt werden konnten. Zunächst ein kurzer Blick auf die Vita von Hansgert Lambers:
Er wurde 1937 in Hannover geboren und ist dort aufgewachsen. Mit 14 Jahren hat er seine erste Kamera bekommen und entflammte umgehend für die Fotografie. Das hat ihn allerdings nicht dazu veranlasst, sich als Fotograf ausbilden zu lassen, vielmehr hat er nach dem Abitur ein Ingenieurstudium (1957-63) in Berlin aufgenommen. Im Anschluss daran ist er bei der IBM als Systemberater eingestiegen. Mit diesem Job (1963-93) waren zahlreiche Reisen verbunden, die ihn in europäische Hauptstädte geführt haben, u.a. London, Paris, Barcelona und insbesondere auch nach Osteuropa und in die DDR. Ein großer Teil der Bilder, die in dieser Ausstellung zu sehen waren, sind auf diesen Reisen entstanden. 1986 hat Hansgert Lambers einen auf Fotografie spezialisierten Verlag, den ex pose verlag, gegründet, der zu einem der wichtigsten deutschen Verlage für Fotografie wurde.
KW: Du hast von deiner fotografierenden Mutter deine erste Kamera geschenkt bekommen. Eine deiner ersten Aufnahmen, eine Gruppe von Kindern auf Spiekeroog, hast du bereits 1951 aufgenommen. Ein anderes Foto, das zwei Jahre später entstanden ist, zeigt zwei junge Frauen. Hat dir deine Mutter den Umgang mit der Kamera erklärt?
HL: Nein, meine Mutter hat mir gar nichts erklärt und meine Bildern auch nie kommentiert.
KW: Du hast also einfach so los fotografiert: deine Umgebung und die Menschen um dich herum. Das machst du ja immer noch. 1957 bist du zum Studium nach Berlin gegangen, das noch sehr vom Krieg gezeichnet war. Wie hast du Westberlin in dieser Zeit erlebt?
HL: Westberlin war noch nicht mit einer Mauer umgeben. Der Weg nach Ostberlin war noch frei. Als Student bin ich oft rüber gefahren. In der Mensa der Humboldt-Universität konnte man preiswert essen. Gegenüber Westdeutschland war Berlin zurückgeblieben. Ich war erstaunt, dort noch so viele Ruinen zu sehen. Meine ersten Fotoausflüge waren eher Zufallsgeschichten, z.B. bin ich mal mit einem Freund kreuz und quer durch Kreuzberg gelaufen und haben dann da fotografiert. Ich bekam ziemlich früh ein eigenes Auto und bin dann oft nach Ostberlin gefahren und habe dort getankt, weil es billiger war. Fotografiert habe ich allerdings in Ostberlin nicht, warum, weiß ich nicht mehr.
KW: Was hat dich in den 1960iger Jahren fotografisch inspiriert? Gab es Ausstellungen, Zeitschriften? Du hattest während des Studiums ja auch die Möglichkeit, London und Paris zu besuchen.
HL: Die Fotozeitschriften waren grausig nach heutigen Vorstellungen. Da wurde das Herbstlaub in allen schönen Farben gezeigt oder auch mal ein nettes Porträt, aber keine Straßenfotografie. Irgendwann habe ich dann zufällig das erste Cartier-Bresson Foto gesehen, das war aber keine Inspiration.
JS: Es gab nicht nur keine Zeitschriften, es gab auch keine Fotogalerien. Und Museen zeigten kaum Fotografie, vielleicht mit Ausnahme der Ausstellung „Family of Man“ (kuratiert von Edward Steichen), die weltweit gezeigt wurde.
HL: Ja, „Family of Man“ habe ich in Hannover gesehen.
JS: In einem Interview mit Mathias Reichelt wurdest du nach Vorbildern gefragt. Es gibt keine Vorbilder, hast du geantwortet, allerdings trotzdem einige Namen genannt: Cartier-Bresson, Gary Winogrand, beides ebenfalls Straßenfotografen, aber auch Ralph Gibson und Bill Brandt. Wie bist du mit deren Arbeit in Kontakt gekommen?
HL: „Perspectives of Nudes“ von Bill Brandt (1961) fand ich ganz aufregend. Das Buch habe ich mir von meiner Mutter zu Weihnachten schenken lassen. Winogrand und Ralph Gibson habe ich erst viel späten in den 1980igern rezipiert.
JS: Da hattest du deinen Stil bereits entwickelt
HL: Ja, mehr oder weniger, obwohl ich nicht sagen kann, warum ich weitergemacht habe. Niemanden interessierte meine Fotografie, ich habe das für mich gemacht. Später bin ich in einen Fotoklub eingetreten, da habe ich Gleichgesonnene gefunden.
KW: Während deiner Tätigkeit für IBM in Osteuropa haben deine Fotoaktivitäten so richtig Fahrt aufgenommen?
HL: Tatsächlich war ich bei IBM nur 6 Jahre für den Ostblock (DDR, Polen, Ungarn, Rumänien …) zuständig und zwar von Wien aus. Meine Wohnung in Berlin habe ich beibehalten, aber während dieser Zeit in Wien gelebt. Die letzten 2 Jahre war ich dann hauptsächlich in der Tschechoslowakei (ČSSR) tätig und habe dort einen Wandel erlebt. Ich hatte schon fast aufgehört zu fotografieren, als ich bei einem Besuch in Brünn (ČSSR) ein riesengroßes Plakat entdeckte, welches auf eine Fotoausstellung hinwies. Da musste ich hin. Neben dem großen Sudek stellten dort auch Amateure ihre Bilder aus. Der Ausstellungskatalog verzeichnete sogar die Adressen der beteiligten Künstler. Daraufhin bat ich meine Computerfreunde, denen doch mal einen Brief zu schreiben mit der Bitte, dass ich sie kennenlernen möchte. Mit diesen Künstlern, die ich dann tatsächlich kennenlernen konnte, habe ich erstmals einen richtigen Austausch erlebt. Wir haben uns gegenseitig Bilder gezeigt und einen regen Austausch gepflegt. Auch nach meiner IBM-Zeit bin ich immer wieder hingefahren. In der CSSR hatte die Fotografie damals schon einen viel größeren Stellenwert als zu jener Zeit in Westdeutschland. Der Fotograf war in der CSSR selbstverständlich ein Künstler.
JS: Schön, dass du uns das berichtest! Ich konnte mir nicht vorstellen, wie du in einem sterilen Rechenzentrum Kontakt zu Fotografen gefunden hast.
HL: Meine Computerfreunde waren fantastisch! Die sind mitgekommen, haben übersetzt, soweit meine Fotografenkollegen nicht deutsch oder englisch sprachen.
KW: Viele deiner Porträts strahlen eine große Zugewandtheit aus, manche der von dir Porträtierten lachen dir zu. Wie hast du das geschafft, wo du doch deren Sprache nicht beherrschst hast?
HL: Ich bin einfach auf die Menschen zugegangen und habe meine Interesse gezeigt, sie zu fotografieren. Ich habe nie aus dem Gebüsch heraus fotografiert, sondern mich immer als Fotograf zu erkennen gegeben.
KW: Du hattest ja auch eine eher kleine Kamera dabei.
HL: Naja, immerhin eine Leica. Heute habe ich eine noch kleinere dabei. (Kramt eine Minox 35 aus der Gürteltasche.)
KW: Erinnerst du dich an alle deine Aufnahmen?
HL: Ja, ich weiß das alles noch. (Erzählt eine Anekdote aus Paris.)
JS: Wie warst du in die West- und Ostberliner Fotoszene eingebunden, als du dann wieder dort gelebt hast? Es gab z.B. Michael Schmidt und die Werkstatt für Fotografie.
HL: Michael Schmidt kannte ich gut, der Kontakt war allerdings nicht so intensiv, wie mit meinen tschechischen Freunden. Die Fotogalerie Nagel war zu jener Zeit ein wichtiger Treffpunkt, dort habe ich z.B. Helmut und Gabriele Nothelfer kennengelernt, und Michael war auch regelmäßig dort. Wir haben uns eigentlich immer gekabbelt, das Schöne war aber, dass er am Ende einräumen konnte: „Du hast ja vielleicht auch recht“. Das habe ich an ihm sehr geschätzt und ich bin sehr betrübt, dass er relativ jung gestorben ist.
Bei einem Besuch in Ostberlin stellte ich fest, dass es auch dort eine Fotogalerie gab, gleich neben dem Kino „International“. Interessanterweise zeigte die Galerie gerade eine Ausstellung eines tschechischen Fotografen (Vilém Reichmann), den ich schon kannte.
Organisator dieser Ausstellung war Christian Borchert und ich bemühte mich darum, ihn kennenzulernen. Etwas später haben wir uns getroffen und sind seitdem sehr eng befreundet gewesen. Durch ihn bin ich in die Ostberliner Fotografenszene eingeführt worden. Ich habe Arno Fischer kennengelernt, Helga Paris und viele weitere. Mir fiel auf, dass die Ostberliner Fotografen sehr genau wussten, was jeder machte. Aus diesen Kontakten entwickelte sich auch das Buch- und Ausstellungsprojekt „DDR Frauen fotografieren“, das 43 Positionen von Fotografinnen aus der DDR versammelte. Das Buch erschien 4 Wochen vor Maueröffnung und war ein großer Erfolg.
JS: Aus der deutschen Fotobuchproduktion jener Jahre sticht die in dem von dir gegründeten ex pose verlag erschienene „edition 365“ heraus. Was war deine Motivation zu dieser Reihe?
HL: Ich wollte etwas mit vergleichsweise geringem Geldeinsatz machen, das aber trotzdem gut aussehen sollte, wo eine in sich geschlossene, möglicherweise auch kleinere fotografische Arbeit gezeigt werden konnte. Zusammen mit dem Gestalter, Kai Olaf Hesse, haben wir ein Heft mit 32 Seiten entwickelt, das auf einem einzigen Offset-Druckbogen (Vorder- und Rückseite) in einer Auflage von jeweils 365 Exemplaren gedruckt werden konnte. Die Seiten wurden schlicht geheftet und in einen Graupappendeckel eingeklebt. Es gab zu dieser Zeit noch keinen Digitaldruck und beim Offsetdruck war eigentlich eine Auflage von 1000 oder mindestens 500 Exemplaren wirtschaftlich notwendig. Bei 365 Exemplaren machte der Drucker gerade noch mit. Die Hefte haben wir dann in Heimarbeit in die Pappdeckel eingeklebt, sodass wir mit wenig Geld etwas herstellen konnten, das nach etwas aussah. Mit Digitaldruck kann man heute kleine Auflagen drucken lassen, deshalb ist das Modell der edition 365 heute eigentlich ausgelaufen. Auch mein Verlag wird nicht weitergeführt.
Publikumsfrage (Dr. Andreas Krase): Ich kenne dich als Bücher- und Ausstellungsmacher. Warum bist du nicht schon früher als Fotograf in Erscheinung getreten?
HL: Ich habe mich nicht um Ausstellungen gerissen, auch deshalb, weil ich meinen Fotografenkollegen, die nicht, wie ich, durch einen Hauptberuf abgesichert waren, den Vortritt lassen wollte. Trotzdem bin ich nicht ganz unsichtbar gewesen, ich erinnere z.B. an meine erste Westberliner Ausstellung „Straßenbekanntschaften“ im Haus am Lützowplatz. Auch bei den Tschechen habe ich zwei Ausstellungen gehabt.
Mitschnitt: Georg Knobloch, Transkription und redaktionelle Bearbeitung: Jürgen Schmidt
HL: Hansgert Lambers
KW: Karen Weinert
JS: Jürgen Schmidt
JS: Das Forum für zeitgenössische Fotografie Dresden präsentierte vom 24. November 2022 bis 20. Januar 2023 einen Ausschnitt aus der Retrospektive des fotografischen Lebenswerks von Hansgert Lambers, die vom 10. Juni bis 7. August 2022 unter dem Titel „Verweilter Augenblick“ im Haus am Kleistpark in Berlin gezeigt wurde. Dem Kurator der Berliner Ausstellung, Herrn Matthias Reichelt, ist herzlich zu danken, dass ein Teil der Arbeiten im Anschluss in Dresden gezeigt werden konnten. Zunächst ein kurzer Blick auf die Vita von Hansgert Lambers:
Er wurde 1937 in Hannover geboren und ist dort aufgewachsen. Mit 14 Jahren hat er seine erste Kamera bekommen und entflammte umgehend für die Fotografie. Das hat ihn allerdings nicht dazu veranlasst, sich als Fotograf ausbilden zu lassen, vielmehr hat er nach dem Abitur ein Ingenieurstudium (1957-63) in Berlin aufgenommen. Im Anschluss daran ist er bei der IBM als Systemberater eingestiegen. Mit diesem Job (1963-93) waren zahlreiche Reisen verbunden, die ihn in europäische Hauptstädte geführt haben, u.a. London, Paris, Barcelona und insbesondere auch nach Osteuropa und in die DDR. Ein großer Teil der Bilder, die in dieser Ausstellung zu sehen waren, sind auf diesen Reisen entstanden. 1986 hat Hansgert Lambers einen auf Fotografie spezialisierten Verlag, den ex pose verlag, gegründet, der zu einem der wichtigsten deutschen Verlage für Fotografie wurde.
KW: Du hast von deiner fotografierenden Mutter deine erste Kamera geschenkt bekommen. Eine deiner ersten Aufnahmen, eine Gruppe von Kindern auf Spiekeroog, hast du bereits 1951 aufgenommen. Ein anderes Foto, das zwei Jahre später entstanden ist, zeigt zwei junge Frauen. Hat dir deine Mutter den Umgang mit der Kamera erklärt?
HL: Nein, meine Mutter hat mir gar nichts erklärt und meine Bildern auch nie kommentiert.
KW: Du hast also einfach so los fotografiert: deine Umgebung und die Menschen um dich herum. Das machst du ja immer noch. 1957 bist du zum Studium nach Berlin gegangen, das noch sehr vom Krieg gezeichnet war. Wie hast du Westberlin in dieser Zeit erlebt?
HL: Westberlin war noch nicht mit einer Mauer umgeben. Der Weg nach Ostberlin war noch frei. Als Student bin ich oft rüber gefahren. In der Mensa der Humboldt-Universität konnte man preiswert essen. Gegenüber Westdeutschland war Berlin zurückgeblieben. Ich war erstaunt, dort noch so viele Ruinen zu sehen. Meine ersten Fotoausflüge waren eher Zufallsgeschichten, z.B. bin ich mal mit einem Freund kreuz und quer durch Kreuzberg gelaufen und haben dann da fotografiert. Ich bekam ziemlich früh ein eigenes Auto und bin dann oft nach Ostberlin gefahren und habe dort getankt, weil es billiger war. Fotografiert habe ich allerdings in Ostberlin nicht, warum, weiß ich nicht mehr.
KW: Was hat dich in den 1960iger Jahren fotografisch inspiriert? Gab es Ausstellungen, Zeitschriften? Du hattest während des Studiums ja auch die Möglichkeit, London und Paris zu besuchen.
HL: Die Fotozeitschriften waren grausig nach heutigen Vorstellungen. Da wurde das Herbstlaub in allen schönen Farben gezeigt oder auch mal ein nettes Porträt, aber keine Straßenfotografie. Irgendwann habe ich dann zufällig das erste Cartier-Bresson Foto gesehen, das war aber keine Inspiration.
JS: Es gab nicht nur keine Zeitschriften, es gab auch keine Fotogalerien. Und Museen zeigten kaum Fotografie, vielleicht mit Ausnahme der Ausstellung „Family of Man“ (kuratiert von Edward Steichen), die weltweit gezeigt wurde.
HL: Ja, „Family of Man“ habe ich in Hannover gesehen.
JS: In einem Interview mit Mathias Reichelt wurdest du nach Vorbildern gefragt. Es gibt keine Vorbilder, hast du geantwortet, allerdings trotzdem einige Namen genannt: Cartier-Bresson, Gary Winogrand, beides ebenfalls Straßenfotografen, aber auch Ralph Gibson und Bill Brandt. Wie bist du mit deren Arbeit in Kontakt gekommen?
HL: „Perspectives of Nudes“ von Bill Brandt (1961) fand ich ganz aufregend. Das Buch habe ich mir von meiner Mutter zu Weihnachten schenken lassen. Winogrand und Ralph Gibson habe ich erst viel späten in den 1980igern rezipiert.
JS: Da hattest du deinen Stil bereits entwickelt
HL: Ja, mehr oder weniger, obwohl ich nicht sagen kann, warum ich weitergemacht habe. Niemanden interessierte meine Fotografie, ich habe das für mich gemacht. Später bin ich in einen Fotoklub eingetreten, da habe ich Gleichgesonnene gefunden.
KW: Während deiner Tätigkeit für IBM in Osteuropa haben deine Fotoaktivitäten so richtig Fahrt aufgenommen?
HL: Tatsächlich war ich bei IBM nur 6 Jahre für den Ostblock (DDR, Polen, Ungarn, Rumänien …) zuständig und zwar von Wien aus. Meine Wohnung in Berlin habe ich beibehalten, aber während dieser Zeit in Wien gelebt. Die letzten 2 Jahre war ich dann hauptsächlich in der Tschechoslowakei (ČSSR) tätig und habe dort einen Wandel erlebt. Ich hatte schon fast aufgehört zu fotografieren, als ich bei einem Besuch in Brünn (ČSSR) ein riesengroßes Plakat entdeckte, welches auf eine Fotoausstellung hinwies. Da musste ich hin. Neben dem großen Sudek stellten dort auch Amateure ihre Bilder aus. Der Ausstellungskatalog verzeichnete sogar die Adressen der beteiligten Künstler. Daraufhin bat ich meine Computerfreunde, denen doch mal einen Brief zu schreiben mit der Bitte, dass ich sie kennenlernen möchte. Mit diesen Künstlern, die ich dann tatsächlich kennenlernen konnte, habe ich erstmals einen richtigen Austausch erlebt. Wir haben uns gegenseitig Bilder gezeigt und einen regen Austausch gepflegt. Auch nach meiner IBM-Zeit bin ich immer wieder hingefahren. In der CSSR hatte die Fotografie damals schon einen viel größeren Stellenwert als zu jener Zeit in Westdeutschland. Der Fotograf war in der CSSR selbstverständlich ein Künstler.
JS: Schön, dass du uns das berichtest! Ich konnte mir nicht vorstellen, wie du in einem sterilen Rechenzentrum Kontakt zu Fotografen gefunden hast.
HL: Meine Computerfreunde waren fantastisch! Die sind mitgekommen, haben übersetzt, soweit meine Fotografenkollegen nicht deutsch oder englisch sprachen.
KW: Viele deiner Porträts strahlen eine große Zugewandtheit aus, manche der von dir Porträtierten lachen dir zu. Wie hast du das geschafft, wo du doch deren Sprache nicht beherrschst hast?
HL: Ich bin einfach auf die Menschen zugegangen und habe meine Interesse gezeigt, sie zu fotografieren. Ich habe nie aus dem Gebüsch heraus fotografiert, sondern mich immer als Fotograf zu erkennen gegeben.
KW: Du hattest ja auch eine eher kleine Kamera dabei.
HL: Naja, immerhin eine Leica. Heute habe ich eine noch kleinere dabei. (Kramt eine Minox 35 aus der Gürteltasche.)
KW: Erinnerst du dich an alle deine Aufnahmen?
HL: Ja, ich weiß das alles noch. (Erzählt eine Anekdote aus Paris.)
JS: Wie warst du in die West- und Ostberliner Fotoszene eingebunden, als du dann wieder dort gelebt hast? Es gab z.B. Michael Schmidt und die Werkstatt für Fotografie.
HL: Michael Schmidt kannte ich gut, der Kontakt war allerdings nicht so intensiv, wie mit meinen tschechischen Freunden. Die Fotogalerie Nagel war zu jener Zeit ein wichtiger Treffpunkt, dort habe ich z.B. Helmut und Gabriele Nothelfer kennengelernt, und Michael war auch regelmäßig dort. Wir haben uns eigentlich immer gekabbelt, das Schöne war aber, dass er am Ende einräumen konnte: „Du hast ja vielleicht auch recht“. Das habe ich an ihm sehr geschätzt und ich bin sehr betrübt, dass er relativ jung gestorben ist.
Bei einem Besuch in Ostberlin stellte ich fest, dass es auch dort eine Fotogalerie gab, gleich neben dem Kino „International“. Interessanterweise zeigte die Galerie gerade eine Ausstellung eines tschechischen Fotografen (Vilém Reichmann), den ich schon kannte.
Organisator dieser Ausstellung war Christian Borchert und ich bemühte mich darum, ihn kennenzulernen. Etwas später haben wir uns getroffen und sind seitdem sehr eng befreundet gewesen. Durch ihn bin ich in die Ostberliner Fotografenszene eingeführt worden. Ich habe Arno Fischer kennengelernt, Helga Paris und viele weitere. Mir fiel auf, dass die Ostberliner Fotografen sehr genau wussten, was jeder machte. Aus diesen Kontakten entwickelte sich auch das Buch- und Ausstellungsprojekt „DDR Frauen fotografieren“, das 43 Positionen von Fotografinnen aus der DDR versammelte. Das Buch erschien 4 Wochen vor Maueröffnung und war ein großer Erfolg.
JS: Aus der deutschen Fotobuchproduktion jener Jahre sticht die in dem von dir gegründeten ex pose verlag erschienene „edition 365“ heraus. Was war deine Motivation zu dieser Reihe?
HL: Ich wollte etwas mit vergleichsweise geringem Geldeinsatz machen, das aber trotzdem gut aussehen sollte, wo eine in sich geschlossene, möglicherweise auch kleinere fotografische Arbeit gezeigt werden konnte. Zusammen mit dem Gestalter, Kai Olaf Hesse, haben wir ein Heft mit 32 Seiten entwickelt, das auf einem einzigen Offset-Druckbogen (Vorder- und Rückseite) in einer Auflage von jeweils 365 Exemplaren gedruckt werden konnte. Die Seiten wurden schlicht geheftet und in einen Graupappendeckel eingeklebt. Es gab zu dieser Zeit noch keinen Digitaldruck und beim Offsetdruck war eigentlich eine Auflage von 1000 oder mindestens 500 Exemplaren wirtschaftlich notwendig. Bei 365 Exemplaren machte der Drucker gerade noch mit. Die Hefte haben wir dann in Heimarbeit in die Pappdeckel eingeklebt, sodass wir mit wenig Geld etwas herstellen konnten, das nach etwas aussah. Mit Digitaldruck kann man heute kleine Auflagen drucken lassen, deshalb ist das Modell der edition 365 heute eigentlich ausgelaufen. Auch mein Verlag wird nicht weitergeführt.
Publikumsfrage (Dr. Andreas Krase): Ich kenne dich als Bücher- und Ausstellungsmacher. Warum bist du nicht schon früher als Fotograf in Erscheinung getreten?
HL: Ich habe mich nicht um Ausstellungen gerissen, auch deshalb, weil ich meinen Fotografenkollegen, die nicht, wie ich, durch einen Hauptberuf abgesichert waren, den Vortritt lassen wollte. Trotzdem bin ich nicht ganz unsichtbar gewesen, ich erinnere z.B. an meine erste Westberliner Ausstellung „Straßenbekanntschaften“ im Haus am Lützowplatz. Auch bei den Tschechen habe ich zwei Ausstellungen gehabt.
Mitschnitt: Georg Knobloch, Transkription und redaktionelle Bearbeitung: Jürgen Schmidt
Hansgert Lambers, London, Hampstead 120 Heath, GB, 1973
Künstlergespräch mit Sandra Rosenstiel (Fotoforum Dresden, 28.10.2023):
SR: Sandra Rosenstiel
MK: Michael Kalinka
JS: Jürgen Schmidt
MK: Herzlich willkommen zu unserem Salon mit Sandra Rosenstil, deren Werke im Fotoforum einen Monat lang ausgestellt waren. Einen Monat: „Ich bin nicht da“. Eine Ausstellung mit Fotografien und Skulpturen.
MK: Sandra, Du hast 1998 bis 2001 Schauwerbegestalterin gelernt, anschließend in Jena am Theater gearbeitet. Von 2006-08 hast du an der UdK in Berlin Bühnenbild studiert und begonnen als Bühnen,- und Kostümbildnerin zu arbeiten. Seit 2007 bist du freischaffend und hast hier in Dresden Bildhauerei (2008-2013) studiert.
MK: Verstehst du dich eigentlich eher als angewandte Künstlerin, die andere Künste mit unterstützt, z.B. am Theater, oder siehst du dich als bildende Künstlerin, die Skulpturen schafft oder fotografiert?
SR: Ich würde diese zwei Kategorien gar nicht benennen, also Darstellende und Bildende Kunst. Das war etwas, womit ich mich die ersten Jahre herumgeplagt habe, als ich Bildhauerei studierte. Es gibt diese Kategorien und ich habe mich zunächst entsprechend einordnen lassen. Mittlerweile benötige ich diese Definitionen nicht mehr. Ich bin Künstlerin und alles, was ich als solche tue, ist am Ende Kunst. Ob man das oder wer dies in irgendwelche Schubladen packen möchte, kann es gerne tun. Mir ist das egal. Mittlerweile sind die Grenzen, gerade in der bildenden Kunst so fließend... Performance, Theater, Installation, was ist Fotografie, was ist Malerei? Alles ist so fluide, wie die Welt letztlich auch.
MK: Wenn ich das richtig sehe, beschäftigst du dich mit den Selbstporträts deiner Serie „Ich bin nicht da“ doch irgendwie auch mit deinem Beruf als Ausstatterin. Das sind alles Rollen, in die du schlüpfst. Siehst du diese Porträts als eine Weiterarbeit deiner Arbeit als Kostüm- und Bühnenbildnerin an? Oder sind die Fotos etwas ganz eigenständiges? Wie siehst du deine Position der Fotografie?
SR: Das sind eigenständige fotografische Arbeiten, die ich nicht als Weiterentwicklung meiner Theaterarbeit sehe. Sie sind natürlich durch die Theaterarbeit geprägt und auch davon inspiriert. Ich arbeite seit vielen Jahre am Theater und habe mich mit vielen Figuren, besonders mit Frauenfiguren intensiv beschäftigt.
MK: Gibt es Geschichten, Rollen und Muster, die dich interessieren?
SR: Ja, einige. Zwei Fotos aus dieser Serie sind tatsächlich von Theaterfiguren inspiriert, mit denen ich gearbeitet habe. Das eine ist Rose Bernd von Gerhart Hauptmann und die andere ist Berenice von Jean Racine. Ich hatte sie im Kopf, als ich diese Fotos gemacht habe. Aber wenn man das nicht weiß, dann sind das erst mal Rollenbilder, die verschiedene Archetypen von Frauen zeigen. Ich stelle sie hier zum ersten Mal aus. Fotografie als solche stelle ich zum ersten Mal aus. Ich habe schon während meines Fachabiturs fotografiert, bevor ich überhaupt am Theater gearbeitet habe. Die Fotografie hat mich seither immer begleitet. Es gibt so viele gute Fotografinnen und Fotografen, dass es für mich nie ein Thema war, Fotos auszustellen, weil ich mich nie als Fotokünstlerin gesehen habe. Und letztendlich ist es Jürgen zu verdanken, dass ich jetzt diesen Schritt gemacht habe. Er hat einige Bilder aus dieser Reihe gesehen und wollte sie der Öffentlichkeit zeigen. Es hat eine Weile gedauert und dann habe ich mir ein Herz gefasst und gesagt: Okay. Ich mache das jetzt und schaue, was passiert.
JS: Ja, ich bin auch froh, dass du dich entschieden hast, die Bilder zu zeigen. Und ich darf vielleicht nochmal kurz auf den Titel deiner Ausstellung zu sprechen kommen. „Ich bin nicht da.“ Bezieht er sich auf die Fotografien, die hier im vorderen Raum ausgestellt sind, oder bezieht er sich auch auf die Werkgruppe der Skulpturen? Und dann haben wir ja im Gang auch noch die SW - Fotos von deiner Familie.
SR: Der Titel bezieht sich auf alle Arbeiten. Ich persönlich mag Titel generell, weil sie ein Versuch sind, diese ganze Fülle an Gedanken, die in die Arbeiten einfließen, zu komprimieren und in etwas Prägnantes zu packen. Manchmal dauert die Suche nach einem Titel fast genauso lange wie die Arbeit selber. Titel können dem Betrachtenden einen Hinweis geben, ob der nun richtig ist oder falsch. Wenn eine Arbeit ohne Titel bleibt, dann hat auch dies seinen Grund. Auch kein Statement kann ein Statement sein. Ich suche nach Titeln, die übergeordnet etwas mit mir und meiner Arbeit zu tun haben. Und natürlich stehen diese Fotos, auf denen man eigentlich immer nur mein Gesicht sieht, im Widerspruch zu dem Titel „Ich bin nicht da“. Teresa Ende hat den Satz „Ich bin ein anderer“ in ihrer Eröffnungsrede verwendet. Wer bin ich? Oder: Ich bin viele? Das sind natürlich Dinge, die da mit hineinspielen.
MK: Das ist schön, was du eben gesagt hast. Subjektiv passt der Titel sehr gut zu der Serie, weil es ja auf der einen Seite Porträts sind, die dich zeigen, aber dann auch wieder nicht zeigen, denn du schlüpfst ja in die Rolle von anderen Frauen. Sind diese Rollen auch etwas, was man bei dir wiederfindet oder was du selbst bei dir findest? Oder sind das nur Rollen?
SR: Na ja, das ist wie in Theaterstücken oder wie in einem guten Buch. Dort gibt es Protagonisten, mit denen man sich identifiziert. Hier sind sicherlich auch Frauen dabei, die in mir bestimmte Gedanken anstoßen bzw. Charakterzüge tragen die ich kenne. Positiv wie negativ.
MK: Sind das ganz individuelle Frauenfiguren, die du hier darstellst? Oder haben die auch einen verallgemeinerbaren Background?
SR: Individuelle Erfahrungen, die man veröffentlicht, sollten meiner Meinung allgemeingültig sein. Bzw. sollten sie dem Publikum zugänglich sein, ohne die Biografie der Künstlerin zu kennen. Ich finde es gut, wenn es eine künstlerische Form gibt, die das Autobiografische einschließt ohne es zur Schau zu stellen.
Mit Übertreibung/ Überzeichnung zu arbeiten ist im Theater nicht ungewöhnlich, um auf das Wesentliche hinzuweisen. Diese Arbeitsweise fließt bei meinen Fotos mit ein. Die Maskenbildnerei im Theater trägt dabei einen großen Anteil der Wirkung. Für meine Fotos habe ich mich selber geschminkt, teilweise sogar nur mit Kinderschminke. Der Auftrag ist etwas schrottig, fleckig. Aber mir gefällt, dass das nicht so glatt und perfekt ist, sondern das es ein bisschen „rough“ ist.
JS: Darf ich vielleicht den den Blick auf die zweite Gruppe von Fotos richten, die Porträts deiner Familie? Kannst du dazu noch etwas sagen? Weil das zumindest auf den ersten Blick etwas ganz anderes ist als das, was du hier vorne zeigst?
SR: Die Porträts sind mehr oder weniger zufällig entstanden. Ich hatte gar nicht den Plan, sie überhaupt zu zeigen. Ich habe vor elf Jahren begonnen, meine Familie zu fotografieren. Ich hatte irgendwann mal privat ein Foto von meinem Vater am Badesee gemacht (das ist der Mann ohne Haare) und dachte, ich würde meine Familie gerne einmal nebeneinander sehen. 2023 habe die Reihe dann wiederholt. Erst durch die Ausstellung habe ich die Gemeinsamkeiten in beiden Arbeiten erkannt. In beiden geht es um die Suche nach Identität.
JS: Es gibt auch einen formalen Aspekt, in dem diese zwei Werkgruppen zueinander finden. Du verwendest immer einen schwarzen Hintergrund, sowohl bei den Familienbildern wie auch bei den Rollenporträts. Steht eine Überlegung dahinter oder eine Absicht?
SR: Mir ging es um die Form. Deshalb sind die Menschen auch nackt. Weil mich diese Form interessiert. Welche Linien beschreibt der Schlüsselbeinknochen? Sehe ich ihn überhaupt? Welche Form ergibt die Schulter im Verhältnis zum Hals...? Durch den zeitlichen Abstand der Aufnahmen, ist auch erkennbar wie sich diese Formen verändern. Dieser schwarze Hintergrund ist eine ganz praktische Überlegung zur Kontrastgebung.
JS: Du hast gesagt, das erste Bild von deinem Vater hast du irgendwo am Badestrand aufgenommen. Wenn ich mir das bildlich vorstelle, ist natürlich schon klar, dass man auf diesem Bild außer dem Vater auch noch den Hintergrund sieht. Und ich vermute, dass du schon die Absicht hattest, den Hintergrund zu eliminieren.
SR: Genau, damit man sich wirklich auf die Figur, auf die Form konzentrieren kann.
Gast: Du kommst vom Theater. Und das Theater geht natürlich eigentlich von der freigestellten Person vor einem dunklen Hintergrund aus. Einige meiner liebsten Inszenierungen, waren einfach schwarze Bühnen, wo zwei Spots die Szene beleuchteten.
JS: Ich will mal kurz zusammenfassen. In den Familienbildern geht es dir um die Form, aber auch darum, dich in deiner Familie wiederzufinden. Deine Identität hat natürlich mit deiner Familie zu tun. Die großen Selbstporträts sind dagegen Rollenbilder, die dich interessieren, aber nicht unbedingt auf dich selbst verweisen. Bei der dritten Werkgruppe (eigentlich sind es zwei) erinnert mich das eine Objekt an ein optisches Instrument, ein Spektiv, das andere an ein Körperorgan. Kannst du noch ein bisschen die Hintergründe aufklären?
SR: Also ich will die Objekte jetzt nicht gänzlich entzaubern. Natürlich könnte ich erzählen, was ich mir dabei gedacht habe, aber dann ist es ja irgendwie, wie wenn ich ein Buch von hinten anfange zu lesen. Die Objekte kommen aus unterschiedlichen Zeiten. Und das, was du jetzt erst mal grob zu diesen beiden Arbeiten gesagt hast, finde ich gar nicht so verkehrt. Auch hier geht es um die Frage nach Wirklichkeit und Wahrnehmung. Meine Objekte hinterfragen vieles und ordnen Gedanken um.
Bis zu meinem Diplom habe ich immer sehr konsequent nach einem Entwurf gearbeitet. Ich habe mir Skizzen gemacht und mir überlegt, wie ich meine Idee konkret umsetzten kann. Und dann habe ich an der Umsetzung abgearbeitet. Später habe ich angefangen, die Arbeit ein bisschen laufen zu lassen ohne genau zu wissen, was am Ende rauskommt. Es gibt immer ein Grundgefühl, eine Annahme, etwas was mich interessiert aber die eigentliche Arbeit, das Kunstwerk, ist fortwährend im Prozess. Bildhauerei ist ein langwieriges Geschäft, man selbst verändert sich während der Zeit des Arbeitens oder die Welt. Dadurch verändert sich auch das Objekt. Ich weiß grob, wo es herkommt und wo es hingehen könnte.
Es gibt immer verschiedene Perspektiven. Ich suche Widerstände. Oft braucht es einige Zeit, bevor ich weiß, was dazugehört. In Bezug auf die Arbeit, die hier gezeigt wird, ist das Thema der Beobachtung weitgefächert. Die Arbeit ist stückchenweise entstanden, zuerst gab es das Bronzeobjekt und irgendwann hat es diesen Ständer bekommen. Und so wuchsen die Teile zusammen.
MK: Es gibt ja viele Spannungen in diesen Objekten. Zum einen die Materialität und dann natürlich, dass die Objekte nicht auf einem klassischen Sockel sitzen. Was ich ganz interessant und spannungsvoll finde, sind die Namen. Das eine ist die Kammer, das ist deine Keramikarbeit, und das andere ist der Beobachter.
SR: Ich versuche irgendwie für das Objekt und das, was gedanklich mit drin steckt, ein Wort zu finden. Das liegt vielleicht auch an meinem theatralen Leben, weil ich Texte und und Sprache mag. Und deswegen ringe ich wirklich lange mit mir, um Titel zu finden. Nicht immer sind sie gelungen, aber ich versuche es trotzdem jedes Mal aufs Neue.
Ich merke, dass die Leute, wenn sie vor meinen Objekten stehen, diese gerne anfassen wollen. Sobald Kunst auf dem Sockel steht oder in einer Vitrine präsentiert wird, wird sie unnahbarer. Das finde ich lebensfern und es nervt mich auch ein bisschen. Deshalb ist es mir so wichtig, dass man sich als betrachtende Person mit Respekt in Bezug zum Kunstwerk setzt. Ich persönlich möchte einen Möglichkeitsraum, der auch damit im Zusammenhang steht wo der Kunstraum beginnt oder aufhört. Ein Sockel begrenzt diese Möglichkeit manchmal.
JS: Ich habe da im Nachgang noch eine Frage zu deinem Werdegang. Wie kommt man vom Bühnenbild zur Bildhauerei? Du hast eben schon ein bisschen die Antwort gegeben: Du willst etwas zum Anfassen haben.
SR: Also, das hat mehrere Gründe. Ich habe mein Bühnenbildstudium nicht abgeschlossen, weil wir schon während des Studiums an großen Theatern gearbeitet haben. In den ersten Jahren habe ich mit meiner Regisseurin viel mit Masken gearbeitet und diese Masken auch selbst angefertigt. Dabei habe ich gemerkt, dass mir das Plastische liegt. Und ich glaube, erst dann habe ich mich getraut, mich für Bildende Kunst zu bewerben. Ich habe immer gedacht, das kann ich nicht. Und erst nach den ersten Jahren am Theater dachte ich: Warum eigentlich nicht?
Gast: Sehen wir hier die komplette Serie oder haben sie für die Ausstellung eine Auswahl getroffen? Sind vielleicht auch humorvollere Porträts darunter?
SR: Es stimmt, die Porträts sind nicht wirklich humorvoll. Ich kenne nicht viele Charaktere, die humorvoll sind, ohne albern zu sein. Vielleicht kann ich mal schauen, ob ich lustige Frauen finde. Vielleicht kann ich das aber auch nicht. Wenn ich klassische Komödien im Theater sehe, finde ich die Inszenierungen meistens nicht lustig. Das sind oft Schenkelklopfer, das ist nicht mein Ding.
Gast: Was macht in Abgrenzung oder in Ergänzung zu den anderen Künsten die Fotografie für dich aus?
SR: Sie ist als künstlerisches Mittel leichter zu verstehen, weil wir alle täglich mit Bildern zu tun haben. Fotografieren ist etwas, was jeder irgendwie schon mal gemacht hat, da gibt es weniger Berührungsängste.
Das ist natürlich mittlerweile auch die größte Schwierigkeit, was ist ein gutes Foto?
Die Entscheidung, die getroffen wird, der Moment, in dem der Auslöser gedrückt wird, ist absolut. Das Foto, das gezeigt wird, verändert sich eigentlich nicht mehr. Ein dreidimensionales Werk hingegen steht immer in Wechselwirkung mit dem Raum, in dem es sich befindet.
Gast: Auf deiner Homepage hast du Fotos von Theaterinszenierungen. Hast du die Fotos selbst gemacht?
SR: Ja, größtenteils. Einige Bilder sind von Theaterfotografen (die Quellen sind angegeben). Es gibt Szenen, wo ich im Gegensatz zu den Theaterfotografen weiß, was passiert. Das kann ein Vorteil sein und ich bin froh, wenn ich rechtzeitig die richtige Belichtungszeit eingestellt habe.
Ich weiß natürlich auch, welche Lichtstimmung kommt. Die Theaterfotografen haben diese tollen, riesigen Kameras, denen die Lichtsituation egal ist. Aber wenn ich weiß, jetzt kommt gleich diese ganz dunkle Stimmung und ich schaffe das überhaupt nicht mit meinem ISO 2000. Auf welchen Stuhl stütze ich jetzt meine Kamera ab, so dass die Aufnahme doch noch irgendwie gelingt. Darin liegt der Ehrgeiz.
Mitschnitt, Transkription und redaktionelle Bearbeitung: Jürgen Schmidt
SR: Sandra Rosenstiel
MK: Michael Kalinka
JS: Jürgen Schmidt
MK: Herzlich willkommen zu unserem Salon mit Sandra Rosenstil, deren Werke im Fotoforum einen Monat lang ausgestellt waren. Einen Monat: „Ich bin nicht da“. Eine Ausstellung mit Fotografien und Skulpturen.
MK: Sandra, Du hast 1998 bis 2001 Schauwerbegestalterin gelernt, anschließend in Jena am Theater gearbeitet. Von 2006-08 hast du an der UdK in Berlin Bühnenbild studiert und begonnen als Bühnen,- und Kostümbildnerin zu arbeiten. Seit 2007 bist du freischaffend und hast hier in Dresden Bildhauerei (2008-2013) studiert.
MK: Verstehst du dich eigentlich eher als angewandte Künstlerin, die andere Künste mit unterstützt, z.B. am Theater, oder siehst du dich als bildende Künstlerin, die Skulpturen schafft oder fotografiert?
SR: Ich würde diese zwei Kategorien gar nicht benennen, also Darstellende und Bildende Kunst. Das war etwas, womit ich mich die ersten Jahre herumgeplagt habe, als ich Bildhauerei studierte. Es gibt diese Kategorien und ich habe mich zunächst entsprechend einordnen lassen. Mittlerweile benötige ich diese Definitionen nicht mehr. Ich bin Künstlerin und alles, was ich als solche tue, ist am Ende Kunst. Ob man das oder wer dies in irgendwelche Schubladen packen möchte, kann es gerne tun. Mir ist das egal. Mittlerweile sind die Grenzen, gerade in der bildenden Kunst so fließend... Performance, Theater, Installation, was ist Fotografie, was ist Malerei? Alles ist so fluide, wie die Welt letztlich auch.
MK: Wenn ich das richtig sehe, beschäftigst du dich mit den Selbstporträts deiner Serie „Ich bin nicht da“ doch irgendwie auch mit deinem Beruf als Ausstatterin. Das sind alles Rollen, in die du schlüpfst. Siehst du diese Porträts als eine Weiterarbeit deiner Arbeit als Kostüm- und Bühnenbildnerin an? Oder sind die Fotos etwas ganz eigenständiges? Wie siehst du deine Position der Fotografie?
SR: Das sind eigenständige fotografische Arbeiten, die ich nicht als Weiterentwicklung meiner Theaterarbeit sehe. Sie sind natürlich durch die Theaterarbeit geprägt und auch davon inspiriert. Ich arbeite seit vielen Jahre am Theater und habe mich mit vielen Figuren, besonders mit Frauenfiguren intensiv beschäftigt.
MK: Gibt es Geschichten, Rollen und Muster, die dich interessieren?
SR: Ja, einige. Zwei Fotos aus dieser Serie sind tatsächlich von Theaterfiguren inspiriert, mit denen ich gearbeitet habe. Das eine ist Rose Bernd von Gerhart Hauptmann und die andere ist Berenice von Jean Racine. Ich hatte sie im Kopf, als ich diese Fotos gemacht habe. Aber wenn man das nicht weiß, dann sind das erst mal Rollenbilder, die verschiedene Archetypen von Frauen zeigen. Ich stelle sie hier zum ersten Mal aus. Fotografie als solche stelle ich zum ersten Mal aus. Ich habe schon während meines Fachabiturs fotografiert, bevor ich überhaupt am Theater gearbeitet habe. Die Fotografie hat mich seither immer begleitet. Es gibt so viele gute Fotografinnen und Fotografen, dass es für mich nie ein Thema war, Fotos auszustellen, weil ich mich nie als Fotokünstlerin gesehen habe. Und letztendlich ist es Jürgen zu verdanken, dass ich jetzt diesen Schritt gemacht habe. Er hat einige Bilder aus dieser Reihe gesehen und wollte sie der Öffentlichkeit zeigen. Es hat eine Weile gedauert und dann habe ich mir ein Herz gefasst und gesagt: Okay. Ich mache das jetzt und schaue, was passiert.
JS: Ja, ich bin auch froh, dass du dich entschieden hast, die Bilder zu zeigen. Und ich darf vielleicht nochmal kurz auf den Titel deiner Ausstellung zu sprechen kommen. „Ich bin nicht da.“ Bezieht er sich auf die Fotografien, die hier im vorderen Raum ausgestellt sind, oder bezieht er sich auch auf die Werkgruppe der Skulpturen? Und dann haben wir ja im Gang auch noch die SW - Fotos von deiner Familie.
SR: Der Titel bezieht sich auf alle Arbeiten. Ich persönlich mag Titel generell, weil sie ein Versuch sind, diese ganze Fülle an Gedanken, die in die Arbeiten einfließen, zu komprimieren und in etwas Prägnantes zu packen. Manchmal dauert die Suche nach einem Titel fast genauso lange wie die Arbeit selber. Titel können dem Betrachtenden einen Hinweis geben, ob der nun richtig ist oder falsch. Wenn eine Arbeit ohne Titel bleibt, dann hat auch dies seinen Grund. Auch kein Statement kann ein Statement sein. Ich suche nach Titeln, die übergeordnet etwas mit mir und meiner Arbeit zu tun haben. Und natürlich stehen diese Fotos, auf denen man eigentlich immer nur mein Gesicht sieht, im Widerspruch zu dem Titel „Ich bin nicht da“. Teresa Ende hat den Satz „Ich bin ein anderer“ in ihrer Eröffnungsrede verwendet. Wer bin ich? Oder: Ich bin viele? Das sind natürlich Dinge, die da mit hineinspielen.
MK: Das ist schön, was du eben gesagt hast. Subjektiv passt der Titel sehr gut zu der Serie, weil es ja auf der einen Seite Porträts sind, die dich zeigen, aber dann auch wieder nicht zeigen, denn du schlüpfst ja in die Rolle von anderen Frauen. Sind diese Rollen auch etwas, was man bei dir wiederfindet oder was du selbst bei dir findest? Oder sind das nur Rollen?
SR: Na ja, das ist wie in Theaterstücken oder wie in einem guten Buch. Dort gibt es Protagonisten, mit denen man sich identifiziert. Hier sind sicherlich auch Frauen dabei, die in mir bestimmte Gedanken anstoßen bzw. Charakterzüge tragen die ich kenne. Positiv wie negativ.
MK: Sind das ganz individuelle Frauenfiguren, die du hier darstellst? Oder haben die auch einen verallgemeinerbaren Background?
SR: Individuelle Erfahrungen, die man veröffentlicht, sollten meiner Meinung allgemeingültig sein. Bzw. sollten sie dem Publikum zugänglich sein, ohne die Biografie der Künstlerin zu kennen. Ich finde es gut, wenn es eine künstlerische Form gibt, die das Autobiografische einschließt ohne es zur Schau zu stellen.
Mit Übertreibung/ Überzeichnung zu arbeiten ist im Theater nicht ungewöhnlich, um auf das Wesentliche hinzuweisen. Diese Arbeitsweise fließt bei meinen Fotos mit ein. Die Maskenbildnerei im Theater trägt dabei einen großen Anteil der Wirkung. Für meine Fotos habe ich mich selber geschminkt, teilweise sogar nur mit Kinderschminke. Der Auftrag ist etwas schrottig, fleckig. Aber mir gefällt, dass das nicht so glatt und perfekt ist, sondern das es ein bisschen „rough“ ist.
JS: Darf ich vielleicht den den Blick auf die zweite Gruppe von Fotos richten, die Porträts deiner Familie? Kannst du dazu noch etwas sagen? Weil das zumindest auf den ersten Blick etwas ganz anderes ist als das, was du hier vorne zeigst?
SR: Die Porträts sind mehr oder weniger zufällig entstanden. Ich hatte gar nicht den Plan, sie überhaupt zu zeigen. Ich habe vor elf Jahren begonnen, meine Familie zu fotografieren. Ich hatte irgendwann mal privat ein Foto von meinem Vater am Badesee gemacht (das ist der Mann ohne Haare) und dachte, ich würde meine Familie gerne einmal nebeneinander sehen. 2023 habe die Reihe dann wiederholt. Erst durch die Ausstellung habe ich die Gemeinsamkeiten in beiden Arbeiten erkannt. In beiden geht es um die Suche nach Identität.
JS: Es gibt auch einen formalen Aspekt, in dem diese zwei Werkgruppen zueinander finden. Du verwendest immer einen schwarzen Hintergrund, sowohl bei den Familienbildern wie auch bei den Rollenporträts. Steht eine Überlegung dahinter oder eine Absicht?
SR: Mir ging es um die Form. Deshalb sind die Menschen auch nackt. Weil mich diese Form interessiert. Welche Linien beschreibt der Schlüsselbeinknochen? Sehe ich ihn überhaupt? Welche Form ergibt die Schulter im Verhältnis zum Hals...? Durch den zeitlichen Abstand der Aufnahmen, ist auch erkennbar wie sich diese Formen verändern. Dieser schwarze Hintergrund ist eine ganz praktische Überlegung zur Kontrastgebung.
JS: Du hast gesagt, das erste Bild von deinem Vater hast du irgendwo am Badestrand aufgenommen. Wenn ich mir das bildlich vorstelle, ist natürlich schon klar, dass man auf diesem Bild außer dem Vater auch noch den Hintergrund sieht. Und ich vermute, dass du schon die Absicht hattest, den Hintergrund zu eliminieren.
SR: Genau, damit man sich wirklich auf die Figur, auf die Form konzentrieren kann.
Gast: Du kommst vom Theater. Und das Theater geht natürlich eigentlich von der freigestellten Person vor einem dunklen Hintergrund aus. Einige meiner liebsten Inszenierungen, waren einfach schwarze Bühnen, wo zwei Spots die Szene beleuchteten.
JS: Ich will mal kurz zusammenfassen. In den Familienbildern geht es dir um die Form, aber auch darum, dich in deiner Familie wiederzufinden. Deine Identität hat natürlich mit deiner Familie zu tun. Die großen Selbstporträts sind dagegen Rollenbilder, die dich interessieren, aber nicht unbedingt auf dich selbst verweisen. Bei der dritten Werkgruppe (eigentlich sind es zwei) erinnert mich das eine Objekt an ein optisches Instrument, ein Spektiv, das andere an ein Körperorgan. Kannst du noch ein bisschen die Hintergründe aufklären?
SR: Also ich will die Objekte jetzt nicht gänzlich entzaubern. Natürlich könnte ich erzählen, was ich mir dabei gedacht habe, aber dann ist es ja irgendwie, wie wenn ich ein Buch von hinten anfange zu lesen. Die Objekte kommen aus unterschiedlichen Zeiten. Und das, was du jetzt erst mal grob zu diesen beiden Arbeiten gesagt hast, finde ich gar nicht so verkehrt. Auch hier geht es um die Frage nach Wirklichkeit und Wahrnehmung. Meine Objekte hinterfragen vieles und ordnen Gedanken um.
Bis zu meinem Diplom habe ich immer sehr konsequent nach einem Entwurf gearbeitet. Ich habe mir Skizzen gemacht und mir überlegt, wie ich meine Idee konkret umsetzten kann. Und dann habe ich an der Umsetzung abgearbeitet. Später habe ich angefangen, die Arbeit ein bisschen laufen zu lassen ohne genau zu wissen, was am Ende rauskommt. Es gibt immer ein Grundgefühl, eine Annahme, etwas was mich interessiert aber die eigentliche Arbeit, das Kunstwerk, ist fortwährend im Prozess. Bildhauerei ist ein langwieriges Geschäft, man selbst verändert sich während der Zeit des Arbeitens oder die Welt. Dadurch verändert sich auch das Objekt. Ich weiß grob, wo es herkommt und wo es hingehen könnte.
Es gibt immer verschiedene Perspektiven. Ich suche Widerstände. Oft braucht es einige Zeit, bevor ich weiß, was dazugehört. In Bezug auf die Arbeit, die hier gezeigt wird, ist das Thema der Beobachtung weitgefächert. Die Arbeit ist stückchenweise entstanden, zuerst gab es das Bronzeobjekt und irgendwann hat es diesen Ständer bekommen. Und so wuchsen die Teile zusammen.
MK: Es gibt ja viele Spannungen in diesen Objekten. Zum einen die Materialität und dann natürlich, dass die Objekte nicht auf einem klassischen Sockel sitzen. Was ich ganz interessant und spannungsvoll finde, sind die Namen. Das eine ist die Kammer, das ist deine Keramikarbeit, und das andere ist der Beobachter.
SR: Ich versuche irgendwie für das Objekt und das, was gedanklich mit drin steckt, ein Wort zu finden. Das liegt vielleicht auch an meinem theatralen Leben, weil ich Texte und und Sprache mag. Und deswegen ringe ich wirklich lange mit mir, um Titel zu finden. Nicht immer sind sie gelungen, aber ich versuche es trotzdem jedes Mal aufs Neue.
Ich merke, dass die Leute, wenn sie vor meinen Objekten stehen, diese gerne anfassen wollen. Sobald Kunst auf dem Sockel steht oder in einer Vitrine präsentiert wird, wird sie unnahbarer. Das finde ich lebensfern und es nervt mich auch ein bisschen. Deshalb ist es mir so wichtig, dass man sich als betrachtende Person mit Respekt in Bezug zum Kunstwerk setzt. Ich persönlich möchte einen Möglichkeitsraum, der auch damit im Zusammenhang steht wo der Kunstraum beginnt oder aufhört. Ein Sockel begrenzt diese Möglichkeit manchmal.
JS: Ich habe da im Nachgang noch eine Frage zu deinem Werdegang. Wie kommt man vom Bühnenbild zur Bildhauerei? Du hast eben schon ein bisschen die Antwort gegeben: Du willst etwas zum Anfassen haben.
SR: Also, das hat mehrere Gründe. Ich habe mein Bühnenbildstudium nicht abgeschlossen, weil wir schon während des Studiums an großen Theatern gearbeitet haben. In den ersten Jahren habe ich mit meiner Regisseurin viel mit Masken gearbeitet und diese Masken auch selbst angefertigt. Dabei habe ich gemerkt, dass mir das Plastische liegt. Und ich glaube, erst dann habe ich mich getraut, mich für Bildende Kunst zu bewerben. Ich habe immer gedacht, das kann ich nicht. Und erst nach den ersten Jahren am Theater dachte ich: Warum eigentlich nicht?
Gast: Sehen wir hier die komplette Serie oder haben sie für die Ausstellung eine Auswahl getroffen? Sind vielleicht auch humorvollere Porträts darunter?
SR: Es stimmt, die Porträts sind nicht wirklich humorvoll. Ich kenne nicht viele Charaktere, die humorvoll sind, ohne albern zu sein. Vielleicht kann ich mal schauen, ob ich lustige Frauen finde. Vielleicht kann ich das aber auch nicht. Wenn ich klassische Komödien im Theater sehe, finde ich die Inszenierungen meistens nicht lustig. Das sind oft Schenkelklopfer, das ist nicht mein Ding.
Gast: Was macht in Abgrenzung oder in Ergänzung zu den anderen Künsten die Fotografie für dich aus?
SR: Sie ist als künstlerisches Mittel leichter zu verstehen, weil wir alle täglich mit Bildern zu tun haben. Fotografieren ist etwas, was jeder irgendwie schon mal gemacht hat, da gibt es weniger Berührungsängste.
Das ist natürlich mittlerweile auch die größte Schwierigkeit, was ist ein gutes Foto?
Die Entscheidung, die getroffen wird, der Moment, in dem der Auslöser gedrückt wird, ist absolut. Das Foto, das gezeigt wird, verändert sich eigentlich nicht mehr. Ein dreidimensionales Werk hingegen steht immer in Wechselwirkung mit dem Raum, in dem es sich befindet.
Gast: Auf deiner Homepage hast du Fotos von Theaterinszenierungen. Hast du die Fotos selbst gemacht?
SR: Ja, größtenteils. Einige Bilder sind von Theaterfotografen (die Quellen sind angegeben). Es gibt Szenen, wo ich im Gegensatz zu den Theaterfotografen weiß, was passiert. Das kann ein Vorteil sein und ich bin froh, wenn ich rechtzeitig die richtige Belichtungszeit eingestellt habe.
Ich weiß natürlich auch, welche Lichtstimmung kommt. Die Theaterfotografen haben diese tollen, riesigen Kameras, denen die Lichtsituation egal ist. Aber wenn ich weiß, jetzt kommt gleich diese ganz dunkle Stimmung und ich schaffe das überhaupt nicht mit meinem ISO 2000. Auf welchen Stuhl stütze ich jetzt meine Kamera ab, so dass die Aufnahme doch noch irgendwie gelingt. Darin liegt der Ehrgeiz.
Mitschnitt, Transkription und redaktionelle Bearbeitung: Jürgen Schmidt
Sandra Rosenstiel, digitale Fotografie aus der Serie "Ich bin nicht da" und Objekt "Beobachtung" aus Bronze, beide 2023